Hans Schreiber arbeitet an einer vielversprechenden Krebstherapie, bei der maßgeschneiderte Immunzellen das entartete Gewebe attackieren und vernichten. Für den 74-Jährigen ist das auch ein ganz persönlicher Kreuzzug.
Text: Alexandra Rigos
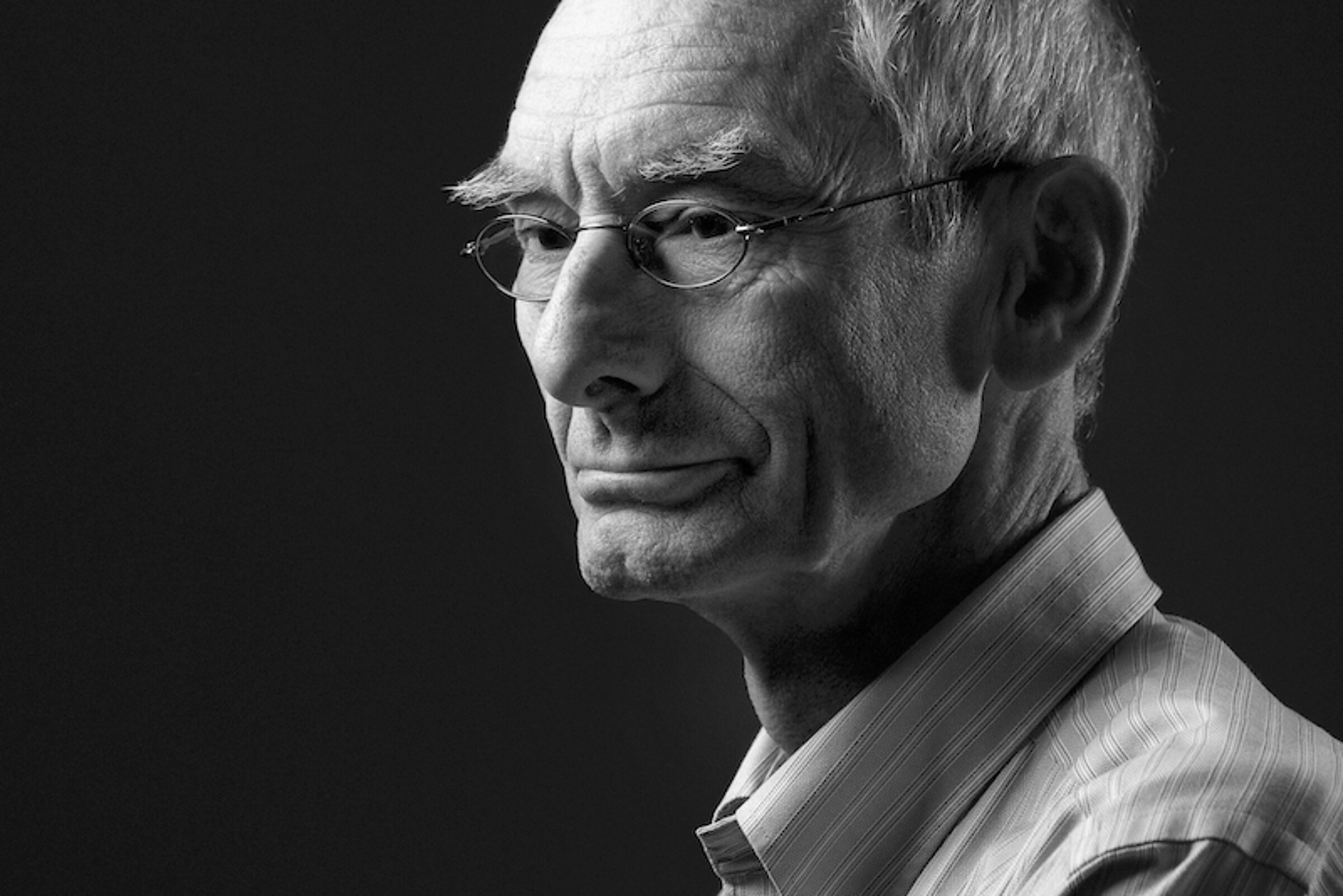
Munter erkunden die beiden dunkelbraunen Mäuse ihre Welt von oben. Sie trippeln über die Gitterabdeckung ihres Käfigs, krallen sich am Rand fest und äugen in die Tiefe. Keines der Tiere scheint sich an dem Krebsgeschwür zu stören, das sich unter ihrem Bauch wölbt.
Dabei hat der Tumor bei der einen Maus immerhin die Größe einer Weintraube. Bei der anderen hingegen ist er nur so groß wie eine Kichererbse. „Und er wird von Tag zu Tag kleiner“, sagt Hans Schreiber, „der Tumor schmilzt nur so dahin.“ An diesem Tier haben Schreibers Kooperationspartner von der Charité und dem Max-Delbrück-Centrum für molekulare Medizin (MDC) eine neuartige Immuntherapie erprobt, die sich eines Tages als Präzisionswaffe im Kampf gegen Krebs bewähren könnte. Zumindest bei Mäusen, die zu Hunderten in sterilen, übereinandergestapelten Plexiglaskästen im Tierhaus des MDC herumwuseln, zeigt die Behandlung sensationelle Erfolge.
Schreiber, Professor für Pathologie an der University of Chicago und von 2014 bis Juli 2018 Visiting Fellow der Einstein Stiftung, gilt als einer der renommiertesten Krebsforscher weltweit. Sein Ansatz der Tumorbekämpfung gehört in das derzeit sehr erfolgreiche Feld der Immuntherapien, bei denen körpereigene Abwehrzellen so modifiziert werden, dass sie den Krebs angreifen. Auch die letztjährigen Medizinnobelpreisträger, James Patrick Allison und Tasuku Honjo, wurden für einen Durchbruch auf diesem Gebiet ausgezeichnet.
Schreibers Methode ist außergewöhnlich, weil er jeden Patienten mit individuell maßgeschneiderten Immunzellen behandeln will, die ausschließlich das entartete Gewebe attackieren.
Der restliche Organismus bleibt unbehelligt. Nebenwirkungen wie Übelkeit oder Haarausfall, die eine Chemotherapie so qualvoll machen, können deshalb nicht auftreten.
Das Immunsystem spielt eine zentrale Rolle bei der Entstehung von Krebs. Doch anders als viele Menschen glauben, sind die Abwehrkräfte nicht etwa generell geschwächt, wenn sich ein Tumor bildet. Vielmehr werden defekte Zellen in aller Regel von der Immunabwehr erkannt und rechtzeitig vernichtet. Weil ihr Erbgut mutiert ist, tragen sie auf ihrer Oberfläche nämlich verräterische Eiweißstrukturen, sogenannte Antigene, die im gesunden Gewebe nicht vorkommen. Die T-Zellen des Immunsystems besitzen Erkennungsmoleküle (Rezeptoren), die wie ein Schlüssel zum Schloss zu den Antigenen passen.
Man kann sich die T-Zellen als – ziemlich gewalttätige – Polizeistreifen vorstellen, die unermüdlich die Ausweispapiere aller Passanten kontrollieren, die ihnen begegnen. Wer den falschen Pass vorzeigt, wird eliminiert. Dazu sondern die Abwehrtruppen aggressive Eiweißstoffe ab, welche die erwischten Zellen durchlöchern und abtöten. Doch in einigen Fällen gelingt es einem Tumor im Frühstadium, die Killerkommandos auszutricksen: Sein molekularer Ausweis ist so geschickt gefälscht, dass er die T-Zellen nicht ernsthaft beunruhigt. Um im Bild zu bleiben, lassen die Kontrolleure die etwas sonderbaren Typen nach kurzem Zögern gewähren. In einem Tumor findet man deshalb T-Zellen, die zwar Krebszellen mit ihren speziellen Mutationen erkennen, sich aber an sie gewöhnt haben. Sie sehen tatenlos zu, wie sich der Krebs ungehemmt ausbreitet.
Schreibers Idee ist es nun, die eingelullten T-Zellen wieder auf Trab zu bringen. Dazu entnehmen die Forscher ihnen jene Rezeptoren, die auf die Krebsantigene ansprechen. Diese „Fahndungsfotos“ setzen sie in unverbrauchte T-Zellen des Patienten ein, die nicht unter dem einschläfernden Einfluss des Tumors standen.
Dann vermehren die Forscher die aufgerüsteten Immunzellen im Reagenzglas, injizieren sie dem Erkrankten in großer Zahl – und bringen den Krebs mit ihrer Hilfe idealerweise zum Verschwinden.
Der Einfall klingt elegant, geradezu bestechend. Zumal die Therapie das Potenzial hat, auch im Körper verstreute Metastasen zu erwischen. Schließlich präsentieren auch die Tochtergeschwulste die Antigene des ursprünglichen Tumors auf ihren Zellen.
Dass der Ansatz prinzipiell funktioniert, haben die Tierversuche bewiesen. „Zum Teil zerfielen die Tumoren so schnell“, erzählt Schreiber, „dass uns die Veterinäre beunruhigt anriefen und fragten, was mit den Mäusen los ist.“ Geht es an die praktische Umsetzung, tun sich allerdings viele Detailprobleme auf. Zudem ist das Verfahren extrem aufwendig. Schließlich sollen bei jedem Patienten individuelle Krebsantigene als Angriffsziel dienen, die es erst einmal zu finden gilt. Dazu muss man das komplette Genom der Tumorzellen entschlüsseln, um die Stellen im Erbgut auszumachen, die den Bauplan der Antigene enthalten.
Doch nicht alle Krebsantigene eignen sich als Zielscheibe. Bei manchen kommen die T-Zellen-Killerkommandos einfach nicht zum Zuge. In den Versuchsreihen mit Mäusen hat Schreibers Team inzwischen Erfahrungen dahingehend gesammelt, welche Merkmale geeignete Antigene aufweisen. Aus diesen Daten lassen sich Algorithmen ableiten, um die Suche nach vielversprechenden Kandidaten zu erleichtern. Um die Sache noch komplizierter zu machen, hat sich herausgestellt, dass ein einziges Antigen für die Heilung nicht ausreicht. Denn Krebszellen verändern sich ständig, sodass stets ein Teil von ihnen dem Immunangriff entwischt – wie auch bei einer Chemotherapie schnell Resistenzen auftreten. Nachhaltigeren Erfolg verspricht die Kombination mehrerer Antigene, die natürlich entsprechend mehr Aufwand mit sich bringt.
Eine neue Erkenntnis von Schreibers Team ist zudem, dass die Heilungschancen steigen, wenn zwei verschiedene Typen von T-Zellen zum Einsatz kommen: Während sogenannte zytotoxische Zellen mit CD8-Rezeptoren die eigentlichen Krebszellen vernichten, greift der CD4-Typus das Stroma an, also das umliegende Gewebe, das den Tumor versorgt. Dessen Zellen sind zwar nicht mutiert, übernehmen aber die Antigene ihrer entarteten Nachbarn. „Wir haben in den letzten vier Jahren gezeigt, dass krebsspezifische Mutationen als Ziel für eine T-Zell-Therapie wirklich vielversprechend sind“, zieht Schreiber die Bilanz seiner Zeit als Einstein Visiting Fellow. Lange musste er auf diesen Erfolg warten. Als er 1995 in einem Paper nachwies, dass Mutationen einzigartige Antigene hervorbringen, die nur in Tumoren vorkommen, wies ihn eine namhafte Fachzeitschrift ab. „Die hielten das für einen technischen Fehler“, erinnert sich Schreiber. Sein Berliner Forschungspartner Matthias Leisegang, Tumorimmunologe am MDC, sagt dazu: „Damals hatte man ja das Humangenom noch nicht einmal entschlüsselt, da war Hans seiner Zeit einfach weit voraus.“
Wenn Schreiber über Krebs redet, wählt er gern starke Begriffe, nennt ihn einen „Mörder“ oder „Einbrecher, der sich in unseren Körper einschleicht“.
In solchen Momenten spürt man, dass der Kampf gegen diese Krankheit für ihn nicht nur eine wissenschaftliche Herausforderung ist, sondern auch ein persönlicher Kreuzzug: Seine Mutter starb an Krebs, dazu einige enge Freunde. Die bekannte Krebsgenetikerin Janet Rowley, Frau von Schreibers Mentor Donald Rowley aus den frühen Chicagoer Jahren, hinterließ ihm sogar eine beträchtliche Summe als Vermächtnis, um damit weitere Forschung zu finanzieren. „Janet kam mit ihren Tumorzellen zu uns“, erzählt Schreiber bekümmert, „aber wir konnten ihr nicht mehr helfen.“
Es wurmt ihn sichtlich, dass seine so verheißungsvolle Methode bislang nicht den Sprung in die klinische Erprobung geschafft hat. Der 74-Jährige verströmt eine geradezu jugendliche Ungeduld. Unbedingt möchte er die praktische Umsetzung seiner Idee erleben, an Ruhestand denkt er nicht.
Ebenso unermüdlich wie eloquent erklärt er seine Arbeit und kritzelt dabei pausenlos Skizzen auf ein Blatt Papier. Dass er am Vortag aus Chicago nach Berlin eingeflogen ist, merkt man ihm kein bisschen an. Würde ihn sein kürzlich operiertes Knie nicht vom Sport abhalten, hätte er heute früh um acht bereits im Schwimmbad seine Bahnen gezogen: „Das hilft gegen den Jetlag“, empfiehlt der Forscher. Zum Glück begeistert sich seine Frau Karin ebenso für T-Zellen 58 wie er selbst. Die gelernte medizinisch-technische Assistentin, die er während seiner Promotion in Freiburg kennenlernte, arbeitet seit Jahrzehnten eng mit ihm zusammen. Noch immer stehen die beiden oft Seite an Seite im Labor.
Zur Krebsforschung kam Schreiber auf dem Umweg über die Strahlenbiologie. Nach seiner Promotion zog es ihn in die USA, wo er am Oak Ridge National Laboratory (ORNL) in Tennessee die Wirkung von krebserregenden Substanzen auf das Erbgut erforschte. Eine vom ORNL geleitete Konferenz über die Immunologie der Krebsentstehung brachte ihn 1972 mit vielen damals führenden Tumorimmunologen in Kontakt – und auf die Idee, sich mit T-Zellen und Immuntherapie zu befassen. So wechselte er 1974 nach Chicago, um mit dem berühmten Immunologen Donald Rowley zu arbeiten.
Das Fellowship der Einstein Stiftung führte den Deutschamerikaner weit zurück in seine Vergangenheit: Schreibers Familie hatte in den Nachkriegsjahren in Berlin gelebt, bevor sie 1952 aus der DDR nach Hamburg umsiedelte. Sein Vater, ein selbstständiger Architekt, hatte sich zunehmenden Anfeindungen durch das Regime ausgesetzt gesehen, und auch Sohn Hans war an der Schule bereits durch missliebige Äußerungen aufgefallen. „Da kam die Lehrerin zu uns nach Hause“, erinnert sich Schreiber, „und drohte: Wenn ich erzähle, was ihr Kind erzählt hat ...“. Dass er selbst einst Flüchtling war, hat Schreiber nicht vergessen, und er schätzt deshalb die Offenheit und Toleranz der deutschen Hauptstadt: „Berlin ist eine sehr inspirierende Stadt.“ Was ihn, neben familiären Bindungen, nach Berlin zog, waren jedoch „die erstklassigen Wissenschaftler“, insbesondere die Arbeitsgruppe von Thomas Blankenstein, der das Institut für Immunologie der Charité leitet. „Die Gruppe hat neuartige Verfahren entwickelt, um genetisch veränderte T-Zellen zu verfolgen, die unsere Möglichkeiten in Chicago gut ergänzen“, erklärt Schreiber. Auch wenn die Förderung durch die Einstein Stiftung nun nach vier Jahren endet, wird die Zusammenarbeit zwischen Chicago und Berlin weiterlaufen. Teamkonferenzen über Skype machen viele persönliche Treffen überflüssig, und Schreiber wird weiterhin oft nach Berlin kommen, wo seine älteste Tochter geboren wurde und seine jüngeren, in Chicago geborenen Zwillingstöchter heute leben.
Seine Hoffnung ist, bald einen Krebspatienten zu finden, dessen Tumor sich für eine Behandlung mit seinen T-Zellen eignet – und dessen Arzt mutig genug ist, das Risiko einer unerprobten Therapie einzugehen.
Noch steckt das Team in dem Dilemma, dass für eine solche Behandlung nur Patienten infrage kommen, denen keine bewährte Behandlung mehr hilft. Die jedoch haben meist nur noch kurz zu leben – aber die Herstellung der aufgerüsteten T-Zellen kann derzeit noch Monate in Anspruch nehmen. Das liegt nicht nur an technischen Schwierigkeiten, sondern auch an den vielen gesetzlichen Vorschriften, denen Schreibers Forschung unterliegt. Um T-Zellen mit den passenden Rezeptoren auszurüsten, kommen gentechnische Verfahren zum Einsatz, die streng reguliert sind. Und schließlich mangelt es an Investoren, die klinische Studien finanzieren könnten. Denn der große Vorteil von Schreibers Immuntherapie ist zugleich ein Handicap: Mit individuell maßgeschneiderten Behandlungen lässt sich schlecht Geld verdienen.
Andere Immuntherapien, etwa die CAR-T-Zell-Therapie gegen Leukämie, setzen an zentralen Schaltstellen des Immunsystems an, die bei allen Patienten gleich sind. Sie versprechen der Pharmaindustrie naturgemäß größere Gewinne. Schreiber hingegen muss einen großen Teil seiner Energie darauf verwenden, Fördermittel für seinen personalisierten Ansatz einzuwerben.
Als Optimist lässt er sich dennoch nicht entmutigen: „Wir brauchen einen klinischen Erfolg“, so seine Überzeugung, „dann wird alles ganz schnell gehen.“
Hans Schreiber ist Professor für Pathologie an der University of Chicago. Von 2014 bis 2018 war er Einstein Visiting Fellow an der Berliner Graduiertenschule für Integrative Onkologie der Charité-Universitätsmedizin Berlin.

