Wie die Digitalisierung unser Leben verändert
Ein Essay von Manuela Lenzen
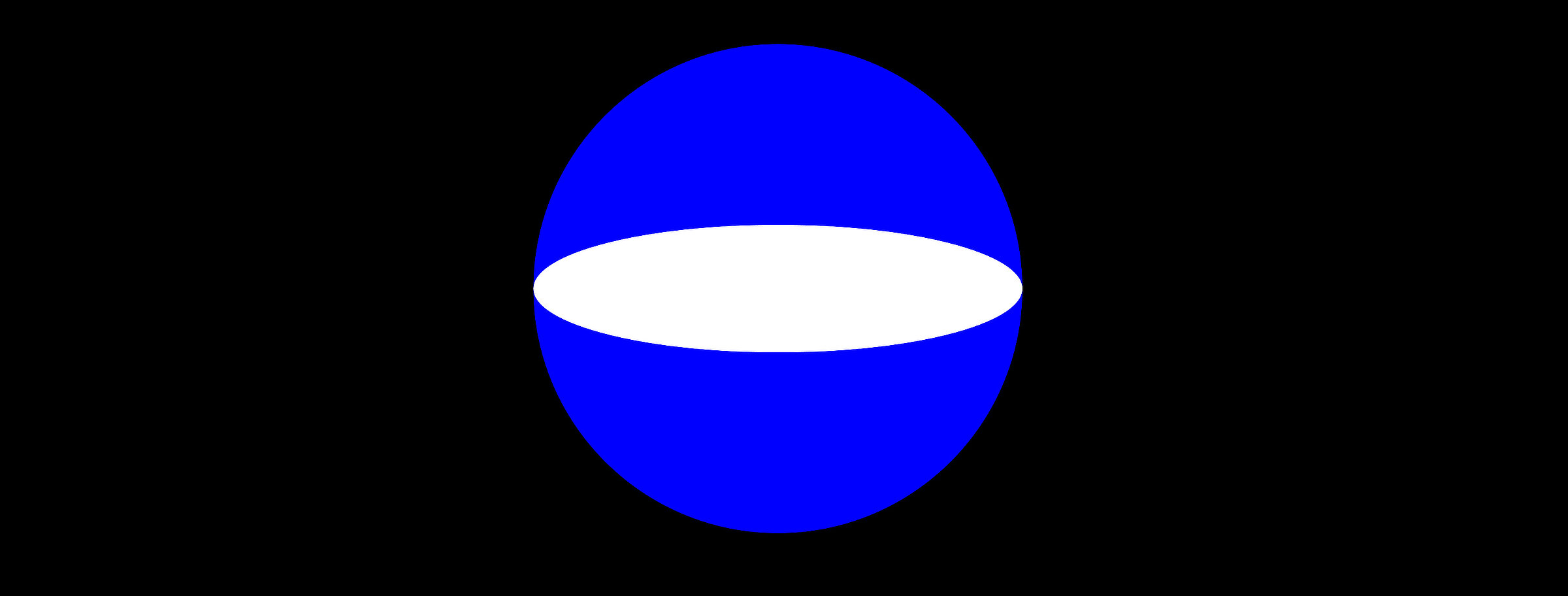
„Computer, erzähl mir alles über die Borgs!” In der Science-Fiction-Serie „Raumschiff Enterprise” war schon vor 50 Jahren selbstverständlich, was wir gerade erst erproben: mit Computern und smarten Geräten zu sprechen wie mit Menschen, Roboter als Arbeitskollegen zu haben und die Haustechnik über intelligente Systeme zu steuern. Die wenigsten Menschen, die damals vor dem Fernseher über die imaginierte Technologie des 23. Jahrhunderts staunten, dürften sich klargemacht haben, was diese mit sich bringt: an ökonomischen, gesellschaftlichen und politischen Umbrüchen und an Herausforderungen für den Einzelnen.
Digitalisierung bedeutet, die Welt für elektronische Systeme lesbar zu machen. Texte, Bilder, Umweltprozesse, Verkehrsströme, Kommunikation, Einkaufs-, Freizeit- und Autofahrverhalten, Vitaldaten: Alles bekommt heute ein digitales Abbild in Form eines Datensatzes. Künstliche Intelligenz hilft dann mit lernenden Algorithmen dabei, diese auszuwerten: Sie zu ordnen, zu durchsuchen und in Beziehung zu setzen. Das beschert uns schon heute Übersetzungssysteme von erstaunlicher Qualität, sprechende Helferlein fast wie in der Science-Fiction und Fortschritte in Medizin und Wissenschaft. Es beschert uns das vielversprechende Date und die passende Playlist, aber auch das in Millisekunden stattfindende Geschacher um die besten Werbeplätze auf unseren Bildschirmen, den unstillbaren Datenhunger der Digitalkonzerne, Überwachungs- und Manipulationsmöglichkeiten, Fakes und Filterblasen.
Nach einer Phase weitgehend unkritischer Begeisterung für all die neuen Gadgets und Möglichkeiten fragen sich viele Menschen inzwischen beunruhigt, was all dies mit uns macht.
Nach einer Phase weitgehend unkritischer Begeisterung für all die neuen Gadgets und Möglichkeiten fragen sich viele Menschen inzwischen beunruhigt bis erschreckt, was all dies mit uns macht. Was geschieht mit uns, wenn wir das Smartphone zwischen uns und die Welt, uns und die Mitmenschen stellen? Wenn Ampeln in den Boden eingelassen werden müssen, weil wir von unserer Umwelt nichts mehr mitbekommen? Was macht es mit uns, wenn wir unser Leben nach den Vorgaben von Apps ausrichten, unser Selbstwertgefühl an Likes hängen und in jeder Minute offline das Gefühl haben, etwas zu verpassen? Das Bild, das Berliner Forscher innen von den Auswirkungen der Digitalisierung zeichnen, ist nicht schwarz oder weiß, es ist bunt, unübersichtlich und voller neuer Fragen.
Wenn Tourist*innen sich grinsend vor dem Berliner Holocaust-Denkmal fotografieren und diese Bilder online posten – ist das dann ein Ausdruck von Ahnungslosigkeit oder von digitaler Geltungssucht? Der Künstler und Comedian Shahak Shapira hat dieses Verhalten 2017 zum Anlass genommen, um auf Social Media gepostete Bilder mit historischem Fotomaterial aus Konzentrationslagern grinsend über Leichenberge. Shapira stieß damit eine Debatte über Handyfotos und Erinnerungskultur an.
Der Kulturanthropologe Christoph Bareither von der Humboldt-Universität zu Berlin (HU Berlin) hat Menschen am Mahnmal beobachtet und interviewt. „Natürlich gibt es Leute, die nicht wissen, wo sie sind, aber wenn man sie fragt, auch die, die lächelnd Selfies machen, stecken oft interessante Geschichten dahinter”, berichtet er. „Sie sagen etwa, sie lächeln nicht, weil sie irgendetwas witzig finden oder der Holocaust ihnen egal ist, sondern weil es ihnen wichtig ist, dort zu sein, und sie es richtig finden, dass sich ein Land so mit seiner Geschichte auseinandersetzt.” Bareither hat auch Bilder und Kommentare in sozialen Medien ausgewertet, die oft mit historischen Kommentaren versehen seien oder mit Beschreibungen, wie sich der Ort anfühle. „Viele Menschen nutzen diese Medien, um durchaus emotional an die Vergangenheit zu erinnern.” Die Knipserei ist also nicht nur Selbstinszenierung. Zumindest manche Menschen suchen damit nach Wegen, sich mit dem Erlebten kreativ auseinanderzusetzen, statt schweigend durch das Mahnmal zu schreiten. Dem mag die egozentrische Annahme zugrunde liegen, das eigene Erleben sei für andere interessant genug, um es in den Social Media auszubreiten. Es mag auch ein Zeichen zu- nehmender Unkonzentriertheit und Unfähigkeit sein, sich auf den Moment einzulassen. Doch es kann ebenso gut am Beginn einer neuen, intensiveren und persönlicheren Auseinandersetzung mit Vergangenheit stehen.
Die Menschheit hat sich Hals über Kopf in die Welt der digitalen Gadgets und sozialen Medien gestürzt. Für einen genaueren Blick, was bei dieser Transformation wirklich mit uns geschieht, fehlt der Forschung allerdings meist noch eine belastbare Datenbasis. Christoph Bareither hält die Frage, was Technik mit dem Menschen macht, ohnehin für zu einseitig. „Natürlich macht digitale Technik etwas mit uns. Aber zugleich machen wir auch immer etwas mit der Technik.” Wir sind also keineswegs nur verführte Opfer, die auf eine neue Technologie hereingefallen sind, sondern auch verantwortliche Akteur innen.
Am Berliner Weizenbaum-Institut für die vernetzte Gesellschaft versucht die Wirtschaftsinformatikerin Annika Baumann zu verstehen, wie wir digitale Technologien nutzen und was für Konsequenzen dies hat, etwa auf unser Wohlbefinden. Mit Kolleg*innen ist sie der Frage nachgegangen, wie soziale Medien unser Selbstbewusstsein beeinflussen. Einfache Antworten hat auch ihr Team nicht gefunden: „Wenn wir uns in den sozialen Medien mit anderen vergleichen, schadet das eher dem Selbstbewusstsein”, sagt sie. „Wenn sich alle sehr positiv darstellen, dann fühle ich mich eher schlechter. Wenn ich aber mein eigenes Profil durchgehe wie ein Tagebuch, wenn ich sehe, was ich alles erlebt und mit wem ich alles Kontakt hatte, wirkt sich das eher positiv auf mein Selbstbild aus.” Viele Likes könnten die Meinung über das Ich stärken, zu wenige es schwächen – weshalb die ersten Plattformen nun dazu übergehen, auf Likes zu verzichten.
Die Digitalisierung macht die Welt auf irritierende Weise durchsichtiger und undurchsichtiger zugleich. Apps maßen sich Aussagen über Gesundheit, passende Partner*innen oder gar die sexuelle Orientierung an.
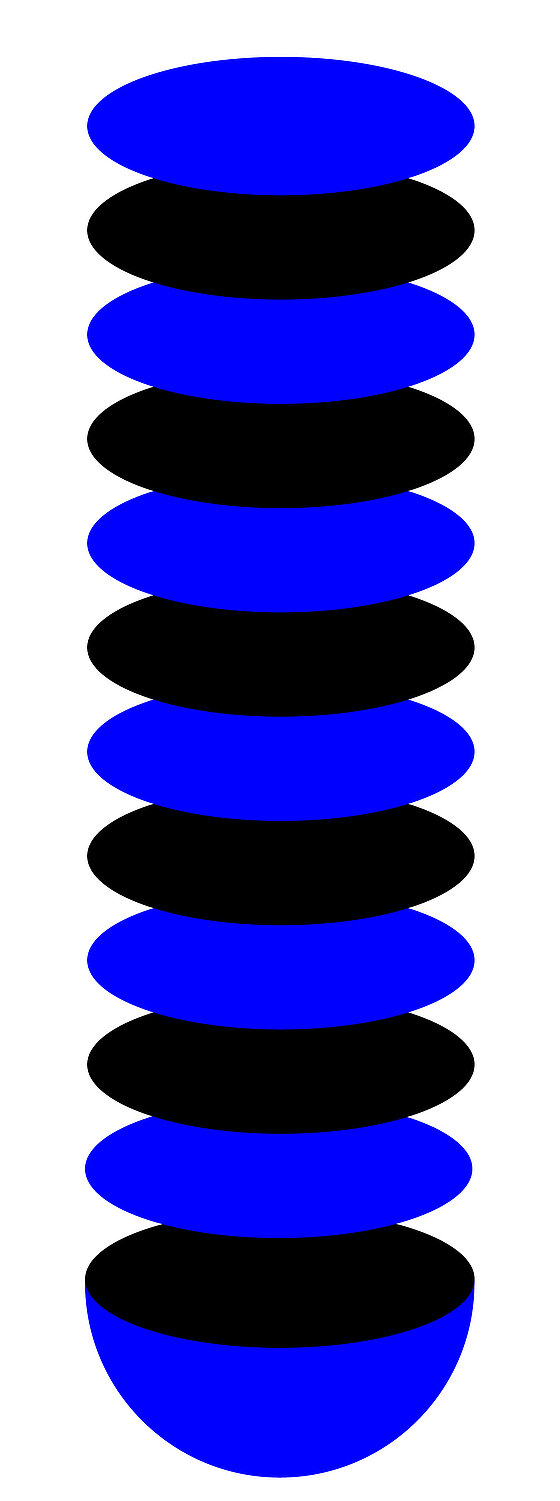
„Insgesamt kann man sagen: Die aktive Nutzung sozialer Medien, um mit anderen in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen, ist vorteilhaft, die passive Nutzung, bei der man sich mit anderen nur vergleicht, eher nicht.” Die Forscherin sieht noch viele Fragen: Welchen Einfluss haben Algorithmen zum Beispiel auf unser Entscheidungsverhalten? Wie stark tragen soziale Medien wirklich zur Bildung von Echokammern bei, in denen die eigene Meinung immer nur bestätigt wird? Oder wie führt man Kinder am besten an soziale Medien heran, damit sie lernen, mit ihnen umzugehen, ohne ihnen zu verfallen?
Die Digitalisierung macht die Welt auf irritierende Weise durchsichtiger und undurchsichtiger zugleich. Apps – oder ihre Entwickler innen – maßen sich Aussagen über Gesundheit, passende Partner innen oder gar die sexuelle Orientierung an. Algorithmen sortieren Bewerbungen und bewerten das Ausfallrisiko von Krediten. Nur, wie sie das tun, bleibt meist im Dunkeln. „Zählen und Daten erheben, das ist so alt wie die Menschheit”, sagt Steffen Mau, Soziologe an der HU Berlin. „Aber durch die Digitalisierung und Quantifizierung des Sozialen werden jetzt alltägliche Handlungen, die früher irrelevant waren, messbar und sichtbar und können über Anreizsysteme oder politische Einflussnahmen gesteuert werden.” Wenn man früher Sport trieb oder bei Rot über die Ampel ging, gab es allenfalls Augenzeug innen.
„Jetzt kann man das alles in Datenarchiven aufbewahren und auswerten. Das eine mag für eine Krankenkasse interessant sein, das andere für einen Onlinehändler. Menschen können nach Dingen klassifiziert werden, die früher gar nicht sichtbar wurden.” China macht mit seinem Social-Scoring-System gerade vor, wie mithilfe umfassender Datenerhebung und ihrer automatischen Analyse die Bevölkerung kontrolliert werden kann. Was immer jemand tut oder nicht tut, wird bewertet und geht auf undurchsichtige Weise in einen Punktewert ein, der mit darüber bestimmt, wohin eine Person reisen und auf welche Schulen sie ihre Kinder schicken darf.
Was sich nicht in Zahlen fassen lässt, verschwindet hingegen leicht aus der Wahrnehmung. Etwa in der Pflegealter und kranker Menschen. „Hier wird ein hochkomplexer Vorgang in kleine messbare Einzelteile zerlegt. Aber wie misst man die Bedeutung eines etwas längeren Händedrucks oder eines Lächelns?”, gibt Mau zu bedenken. Im Zuge der Quantifizierung von allem und jedem drohe die Menschlichkeit auf der Strecke zu bleiben.
Auch der Einzelne ergibt sich leicht der Magie des Messbaren, lässt jeden Schritt messen, den er am Tag zurücklegt, wie oft er nachts erwacht, den Blutdruck oder die Pulsfrequenz. „Zahlen haben etwas Auratisches, sie gelten als neutral und objektiv. Doch sie spiegeln die Realität gar nicht eins zu eins wider, sondern nur eine sehr spezifische Lesart davon”, so Mau. Wenn wir einen Text aufrufen oder ein Produkt online betrachten, beeinflussten die Anzahl der Downloads oder Sternchen unsere Erwartung. „Und wenn uns der Fitnesstracker sagt, wir seien gesund, obwohl wir uns nicht wohlfühlen, passen wir im Extrem das Gefühl den Zahlen an, statt uns auf unsere Selbstwahrnehmung zu verlassen.” Offenbar müssen wir erst lernen, uns von der Macht der Zahlen zu emanzipieren, wenn wir in einer digitalisierten Gesellschaft Mensch bleiben wollen.
Was unter der Oberfläche der Scores und Sternchen vor sich geht, bleibt dem Nutzenden zudem in aller Regel verborgen. „Wir alle wissen, dass sich hinter dem Bildschirm ein ganzes Universum von Interaktionen erstreckt, die sich ausbreiten wie ein Geflecht von Pilzen: Algorithmen, Protokolle, Datenbanken, die vom Nutzer nicht einsehbar oder kontrollierbar sind”, sagt die Philosophin Sybille Krämer von der Freien Universität Berlin. Sie stellt die Digitalisierung in eine lange kulturelle Tradition der „Verflachung”. Das ist positiv gemeint: „Erst indem wir Dinge niederschreiben, aufzeichnen, notieren, sie also in zwei Dimensionen bannen, können wir kreativ mit ihnen umgehen”, erklärt sie. Architektur, komplexe Musik, Mathematik seien ohne Niederschriften und Skizzen gar nicht möglich. „Aber bislang ging die Kulturtechnik der Verflachung mit einem Transparenzversprechen einher. Gedanken wurden nachvollziehbar und kritisierbar, indem sie niedergeschrieben wurden”, so Krämer. Das werde durch die vernetzten Rechensysteme gebrochen: „Zum einen wissen wir nicht, was mit unseren Eingaben geschieht. Zum anderen haben wir es immer häufiger mit Algorithmen zu tun, die wir nicht nachvollziehen können. Hier tut sich eine neue Intransparenz auf.”
Auch deshalb ist vielen die digitale Revolution längst unheimlich und hat sie zu Gegenbewegungen geführt. Eines zeigt sich in der Renaissance des Analogen: Je billiger die digitalen Gadgets, je allgegenwärtiger die Plattformökonomie, desto gefragter werden auch wieder Schallplatten, Sofortbildkameras und Brettspiele. Selbst die Kultur der Salons wird wiederbelebt. Man trifft sich wieder in der analogen Welt, zur Fastenzeit betreibt man digital detox: einfach mal offline sein. Nicht das neueste Handy, sondern die Freiheit, sich auszuloggen, zeigt, was man sich leisten kann. Politischer ist der „Techlash”, eine Protestbewegung gegen die Techkonzerne: Sie steht für die radikalere Version der Digitalisierungskritik. Die Forderungen ihrer Vertreter innen reichen von einer gerechteren Besteuerung der Digitalkonzerne bis zu ihrer Zerschlagung oder der Sozialisierung aller Datenbestände.
Es scheint, als hätten wir noch einiges zu lernen, bis wir einen weisen Umgang mit der Digitalisierung und ihren Möglichkeiten und Gefahren gefunden haben. Sybille Krämer wünscht sich für diesen Prozess eine neue Aufklärung, die das Transparenzversprechen erneuert, die klassische europäische Aufklärung aber in einem wichtigen Punkt korrigiert: „Die Aufklärung ging immer vom Ego aus, davon, dass einer alleine in seinem Kopf Erkenntnisse produziert. Jetzt wird immer deutlicher, dass jede Form geistiger Tätigkeit eine kollektive Tätigkeit ist und Wissenserzeugung ein kooperativer, sozialer Prozess.” Freilich sei zugleich das Individuum gefragt, sich seine Souveränität im Denken angesichts der Verführungen und Irritationen der digitalen Welt zu erhalten. Doch dieses Paradox sei nicht neu: „Nur eine falsch verstandene Aufklärung kann glauben, dass es eine Welt ohne Ambivalenzen geben könnte.”

