In der Corona-Krise berufen sich alle Seiten auf die Verfassung. Der Rechtswissenschaftler Christoph Möllers spricht über die Minderheiten-Rhetorik der Querdenker, den schmalen Grad der Freiheit und die Aufgabe der Rechtswissenschaft, die Argumente und Entscheidungen der Gerichte zum Infektionsschutz systematisch aufzuarbeiten
Interview: Maximilian Steinbeis
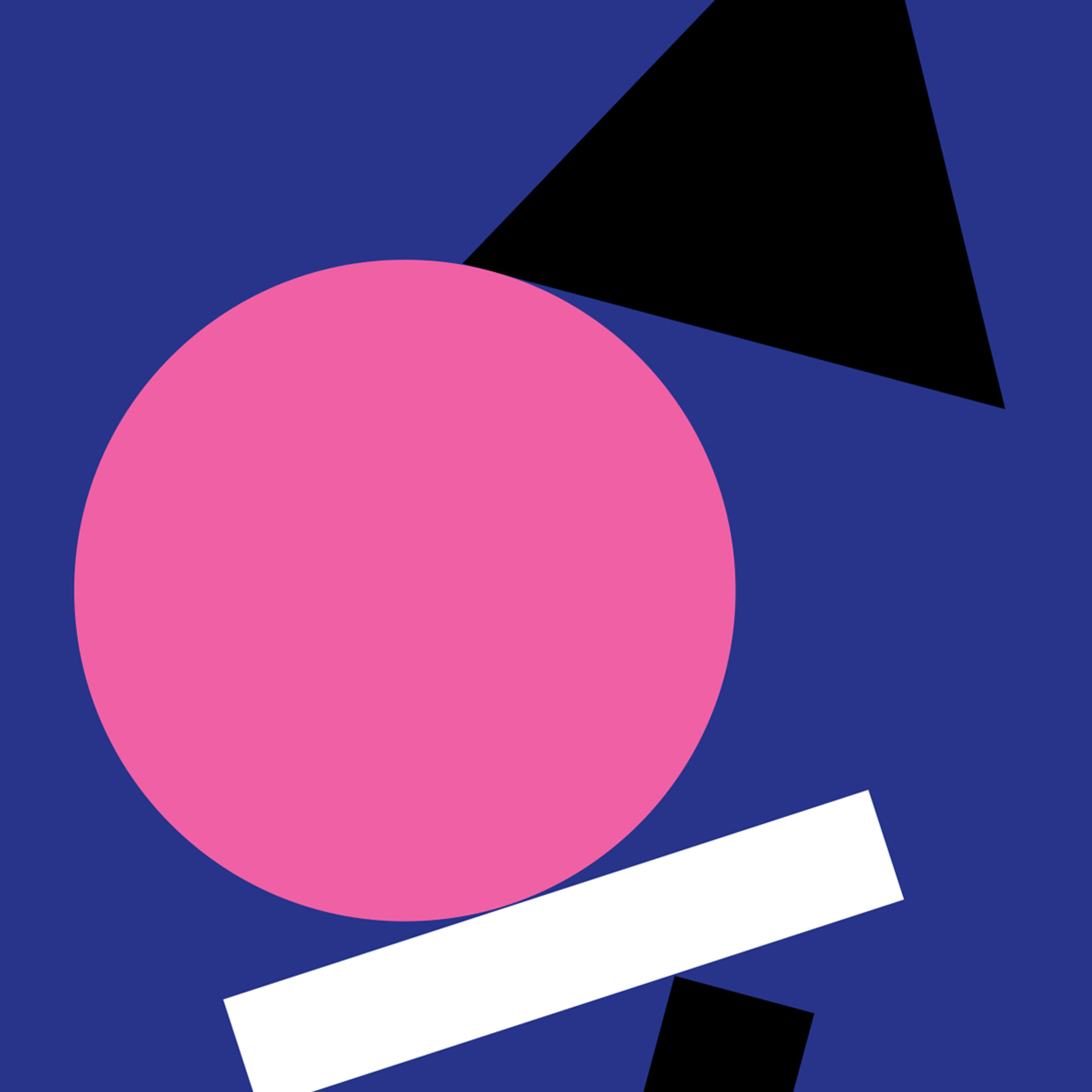
In der Corona-Krise war die Rechtswissenschaft in der Öffentlichkeit so gefragt wie lange nicht mehr. Es gab vor allem eine enorme Nachfrage nach dem, was Verfassungsrechtler*innen wissen. Warum? Versteht sich diese Aufmerksamkeitskonjunktur von selbst?
Nein, das hat mich schon überrascht. Das hing wohl auch damit zusammen, dass jedenfalls am Anfang, im Frühjahr 2020, Deutungsangebote etwa aus den Sozialwissenschaften weitgehend ausblieben. Offenkundig wurde auch, und das war mir vorher nicht so klar, dass das Verfassungsrecht tatsächlich die einzige normative Ordnung ist, die wir wirklich teilen. Es stellten sich Fragen der Bewertung. Was sind die Maßstäbe für die Bewertung? Moralische, religiöse oder rein instrumentelle? Die sind natürlich als solche schon ewig umstritten, während wir bei der Verfassung zwar vielleicht darüber streiten, wie wir sie deuten, aber weniger darüber, dass sie uns überhaupt verpflichtet und verbindet. Alle berufen sich ja auf die Verfassung. Das ist auch durchaus ein Problem. Aber erst einmal ist es ein interessanter Umstand, dass die Verfassung offensichtlich eine übergreifende Verbindlichkeit beansprucht, die sonst kein anderes Normensystem hat.
War das so in anderen Ländern auch zu beobachten? Ist das ein deutsches Phänomen oder findet sich das in anderen Rechtsordnungen und -kulturen genauso?
Es ist jedenfalls kein selbstverständliches Phänomen, das es überall gibt. In Frankreich oder Großbritannien würde man eher genuin politisch argumentieren, mehr mit common sense oder problemlösungsorientiert. Andererseits, in den USA sind solche Referenzen an die Verfassung in solchen Zusammenhängen schon eher üblich. Aber das sind vermutlich eher Ausnahmen.
Zu beobachten war ja nicht nur die Referenz auf das Recht, sondern auch auf die Wissenschaft – dass es eben gerade Jura-Professor*innen sind, die gefragt werden und Platz in den Feuilletons eingeräumt bekommen. Ist das ein deutsches Spezifikum?
Ja und nein. Auch in anderen Ländern gibt es ein Interesse an Verfassungsrechtler*innen. Auf der anderen Seite haben wir in Deutschland eine starke Tradition der dogmatischen Aufbereitung und Professoralisierung des Verfassungsrechts. Wir haben ja auch relativ viele Professor*innen im Verfassungsgericht. Interessant ist zudem, dass es innerhalb unserer Zunft sehr umstritten ist, ob man überhaupt den Weg in die Öffentlichkeit gehen soll. Den Streit haben wir intern relativ robust geführt. Es gab durchaus viele Kolleg*innen, die gesagt haben: Wir machen Wissenschaft, und das ist etwas anderes, als unterkomplexe Zeitungsinterviews zu geben.
Außerdem schuldet man dem politischen System eine gewisse Loyalität. Deswegen haltet euch mal lieber aus der Öffentlichkeit raus. Ich habe öfter gehört, dass Kolleg*innen selbst bei wissenschaftlichen Artikeln, die in Fachzeitschriften erschienen, ein bisschen sauer darüber waren, wenn in der Krise verfassungsrechtliche Probleme angemahnt wurden. Ein ganz interessantes Selbstverständnis also, einerseits eine staatsloyalistische und andererseits eine introvertierte Wissenschaftlichkeit, die eigentlich meint, man würde seine eigene Expertise irgendwie infrage stellen, wenn man mit der Öffentlichkeit kommuniziert.
Wirkt die Krise denn in die Rechtswissenschaft zurück?
Wenn in der theoretischen Physik oder der Klimawissenschaft oder der Virologie Leute mit superkomplizierten Modellen operieren und es gleichzeitig für richtig halten, mit der Öffentlichkeit zu kommunizieren, dann werden wir Verfassungsrechtler wohl anerkennen müssen, dass wir doch die eher einfachere Disziplin vertreten. Eine Verfassung, die allen Bürgerinnen und Bürgern gehört, muss ja auch alle adressieren können. Ich halte diese Zurückhaltung deshalb für Quatsch. Aber das hat wohl auch mit einem etwas konservativen Vorverständnis unseres Fachs zu tun, dass solche Entwicklungen wie die seit Jahrzehnten diskutierte Frage, wie man als Wissenschaftler*in in die Öffentlichkeit geht, ob man Sachbücher schreibt und so weiter, erst mit Verspätung anlanden. Und natürlich hat das auch mit Herrschaftswissen zu tun: Wenn man sagt, was wir hier machen ist superkompliziert, das versteht ihr alle eigentlich gar nicht, dann schließt man sich gegen öffentliche Kritik ab.
Nicht nur wissenschaftsintern, auch aus der Politik gab es teilweise gereizte Reaktionen auf den Input der Rechtswissenschaft, gerade aus dem Bundestag. War da etwas dran?
Ich finde es richtig, dass die Politiker*innen auch dagegenhalten. Da kommt der Herr Professor oder die Frau Professorin und sagt, das ist alles verfassungswidrig. Ich persönlich versuche in dieser Art von Kommunikation immer zu sagen: Manche sehen es so, manche so, trotzdem sehen die meisten vielleicht hier eher ein Problem als dort. Deswegen sollten die Politiker*innen durchaus sagen, wenn sie das für falsch halten. Es gab aber zwei Phänomene, die interessant waren. Einmal gab es innerhalb der Politik einen Konflikt zwischen Gesundheitspolitiker*innen und Rechts- und Innenpolitiker*innen. Erstere waren von allen genervt, die verfassungsrechtliche Zweifel formulierten. Das halte ich für absolut legitim. Solche fachpolitischen Anliegen muss man aushandeln. Problematischer war, dass teilweise der Druck gerade bei den Regierungsfraktionen sehr hoch schien, an die Grenze dessen zu gehen, was zulässig war. Da wurde man recht robust angegangen, auch für teilweise triviale Feststellungen wie die, dass der Bund das eigentlich alles selbst regeln könne, weil es eine Gesetzgebungskompetenz des Bundes für das gibt, was in den Rechtsverordnungen der Länder geregelt ist. Das war nun keine großartige Erkenntnis, sondern schlicht dem Grundgesetz zu entnehmen.
Wie steht es um die Corona-Krise als Studienobjekt für Verfassungsrechtswissenschaft? Sie haben das mal als ein „großes Experiment“ bezeichnet. Was sind aus Ihrer Sicht die interessantesten Erträge dieses Experiments?
Das Experiment läuft ja noch. Was ich mir wünschen würde, wäre ein Versuch, systematisch vor, während und nach der Krise zu verfolgen, wie argumentiert wurde und was die Gerichte eigentlich gemacht haben. Haben sich die Maßstäbe über die Zeit entspannt oder verschärft? Haben wir hier mit anderem Maß gemessen als dort? Wer wurde da eigentlich zitiert? Man könnte da eine gute, juristisch informierte Diskursanalyse machen und sich ansehen, wo die Argumente herkommen, vielleicht mit quantitativen Mitteln und mit der ganzen Fülle der verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung, die es da gibt. Aber das ist erst einmal eher ein Forschungsdesiderat als etwas, das wir jetzt schon machen können. Wir haben neue Probleme, wie die Frage zum Umgang mit Geimpften. Vor allem aber haben wir, was die Gerichte angeht, immer noch fast nur Entscheidungen im einstweiligen Rechtsschutz und so gut wie keine in der Hauptsache. Was ich jedenfalls sehr schade fände, wäre, wenn wir diesen Moment verstreichen ließen, um zum (vermeintlichen) Status quo ante zurückzukehren.
Zurück zur Öffentlichkeit und dem Teil von ihr, der die Corona-Politik der Bundesregierung und der Landesregierungen kritisch begleitet hat, bis hin zu den sogenannten Corona-Leugner*innen: Hier wird enorm viel Gebrauch von verfassungsrechtlichen Topoi gemacht, man beruft sich auf Grundrechte, Demokratie und Meinungsfreiheit, und zwar permanent und in höchster Intensität. Was ist das für ein Phänomen? Was für ein Verständnis von Verfassung steckt dahinter?
Das ist in der Tat neu für uns. Wir haben hier eine Art soziale Bewegung, die sich in einer Weise auf die Verfassung beruft, wie es die Friedensbewegung oder die Ökologen oder Pegida nicht gemacht haben. Wir kennen das aber aus den USA. Die Tea Party war auch eine dezidiert konstitutionelle Bewegung. Wir kennen es auch aus der Schweiz, ein republikanischer Konstitutionalismus von rechts. Da gibt es etwas in der Welt der Verfassungsstaaten, das jetzt auch bei uns ankommt. Ich finde das eigentlich erst mal gar nicht so schlecht. Natürlich kann ich mit Querdenkern und Corona-Leugnerinnen nichts anfangen. Ich denke aber auch, dass wir damit daran erinnert werden, dass der Umgang mit der Verfassung nicht komplett in einen juristischen Expertendiskurs aufzulösen ist. In der Bundesrepublik war die Tendenz ja sehr stark, zu sagen, das machen Professor*innen und Gerichte, und das war’s. Den Gedanken, dass sich eigentlich alle auf die Verfassung berufen können und an sie gebunden sind, hat Peter Häberle in den 70er Jahren schon formuliert und als „offene Gesellschaft der Verfassungsinterpreten“ bezeichnet, freilich ohne große Folgen. Wir müssen uns damit abfinden, dass die Verfassung, wenn sie denn eine Verfassung für jedermann ist, auch für Dinge in Anspruch genommen werden kann, die sich nicht im juste milieu des Liberalismus bewegen.
Ist das wirklich nur ein Phänomen von Meinungsvielfalt in der offenen Gesellschaft der Verfassungsinterpret*innen? Die Tea Party ist inzwischen beim Sturm auf das Kapitol angelangt. Findet da nicht auch eine Bemächtigung von rechts statt? Der weiße christliche Waffenbesitzer, der sich inszeniert als jemand, der sich gegen eine übermächtige und übergriffige Mehrheit zur Wehr setzen muss und dafür Rechte ins Feld führt?
Es gibt ein allgemeines Phänomen, dass die Rechte linke Semantiken und linke Techniken übernimmt: demonstrieren gehen, die Rhetorik des Volkes, der Selbstbestimmung, des Minderheit-Seins. Das alles wird jetzt am anderen Ende des politischen Spektrums übernommen. Solche Übernahmen finden wir immer mal wieder in der Geschichte politischer Auseinandersetzungen. Die einen erfinden Techniken, die anderen reißen sie sich unter den Nagel. Andererseits kommen wir nicht an dem Faktum vorbei, dass konkret die Corona-Maßnahmen sehr grundrechtsintensiv waren. Dieser Eingriff wurde von der Mehrheit für richtig gehalten. Deswegen ist diese Minderheiten-Rhetorik der Querdenker nicht völlig unplausibel. Auch ein gerechtfertigter Eingriff kann eine harte Freiheitsverkürzung sein. Anders als bei der Flüchtlingskrise, wo ich den rechtlichen Ansatzpunkt nicht erkennen konnte, ist das hier schon ein relativ plausibles Anwendungsfeld für eine robuste Einforderung von Grundrechten. Selbst wenn man das in der Sache für unpassend und falsch hält.
Was den coronaskeptischen Diskurs obendrein befeuert, ist die Tatsache, dass die Corona-Krise als Public-Health-Krise zumindest in Deutschland ja immer hypothetisch blieb. Es ist gottlob nicht dazu gekommen, dass sich die verheerenden Szenarien, auf die die Maßnahmen gestützt wurden, sich tatsächlich verwirklicht haben – das berühmte Präventionsparadox. Wie gut sind wir insoweit auf die nächste, noch viel größere und existenziellere Krise vorbereitet, nämlich die Klimakrise?
Naja. Wir hatten doch über 90.000 Tote. Das war schon schrecklich, und sehr viele Leute haben das in ihrem Bekannten- und Freundeskreis direkt mitbekommen. Das war auch eindeutig zuzurechnen. Da brauchte es keine lange Kausalkette, um zu erkennen, dass Leute an einer Krankheit sterben, von der ein paar vorher behauptet hatten, sie sei eine Grippe. Daher sehe ich das kognitive Problem, dass man die Gefahr nicht sehen oder fühlen kann, hier gar nicht so dramatisch. Was wiederum die Klima- und andere prognostizierte Krisen angeht, bin ich sehr pessimistisch geworden, sowohl was die Vorhersehbarkeit von Ereignissen angeht als auch was die Implikationen betrifft, wenn sie denn mal prognostiziert wurden. Was die Vorhersehbarkeit angeht, erinnere ich heute, am 19. August, daran, dass das Auswärtige Amt noch vor zehn Tagen im Bundestag erklärt hat, dass die Taliban sich nicht auf Kabul richten würden. Da würde ich gar keinen bösen Willen unterstellen. Offensichtlich ist es sehr schwer, auch sehr dramatische Sachen relativ kurzfristig vorherzusehen. Dann erinnere ich mich wieder an den letzten Herbst und denke: Da wusste eigentlich jeder im Oktober schon, dass das, was die Ministerpräsidentenkonferenz beschlossen hat, nicht ausreichen würde. Viele Dinge wissen wir gar nicht erst. Aber selbst dann, wenn wir Dinge wissen, reagieren wir darauf nicht.
Was heißt das für die Klimakrise?
Bei der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz sind mehr Leute umgekommen als an der Berliner Mauer bis 1989. Aber wie genau die Kausalkette verläuft, ist nicht so klar. Man kann wohl schon sagen, dass die Rechtfertigung für Freiheitseinschränkungen mit Blick auf die Klimakrise mit jedem Jahr plausibler wird. Ob der Staat zu sehr in die Rechte eingreift, um uns vor dem Klimawandel zu schützen, erscheint mir aber solange eine total akademische Diskussion, wie wir nicht gleichzeitig fragen, ob der Staat überhaupt die Minimalstandards dessen, was einigermaßen vertretbar ist, verwirklicht, um das Klima zu schützen. Was mir an der Klima-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts gut gefällt, ist, dass sie an einer Art Zweck-Mittel-Ratio ansetzt und dem Gesetzgeber sagt: Ihr habt euch auf das Pariser Übereinkommen verpflichtet. Ihr habt das auch ins Gesetz geschrieben. Wir sagen euch: Tut das Notwendige, um diesen Zweck zu erfüllen.

Christoph Möllers lehrt als Professor für Öffentliches Recht an der Humboldt-Universität zu Berlin Verfassungsrecht und Rechtsphilosophie. 2020 erschien sein Buch „Freiheitsgrade. Elemente einer liberalen politischen Mechanik“ bei Suhrkamp.
Stand: Dezember 2021

