Der Politikwissenschaftler Daniel Ziblatt über den bedenklichen Zustand der Demokratie in den USA, wie Autokrat*innen sie weltweit attackieren – und wie man den Gegner*innen der Demokratie das Leben schwer machen kann
Interview: Christoph David Piorkowski
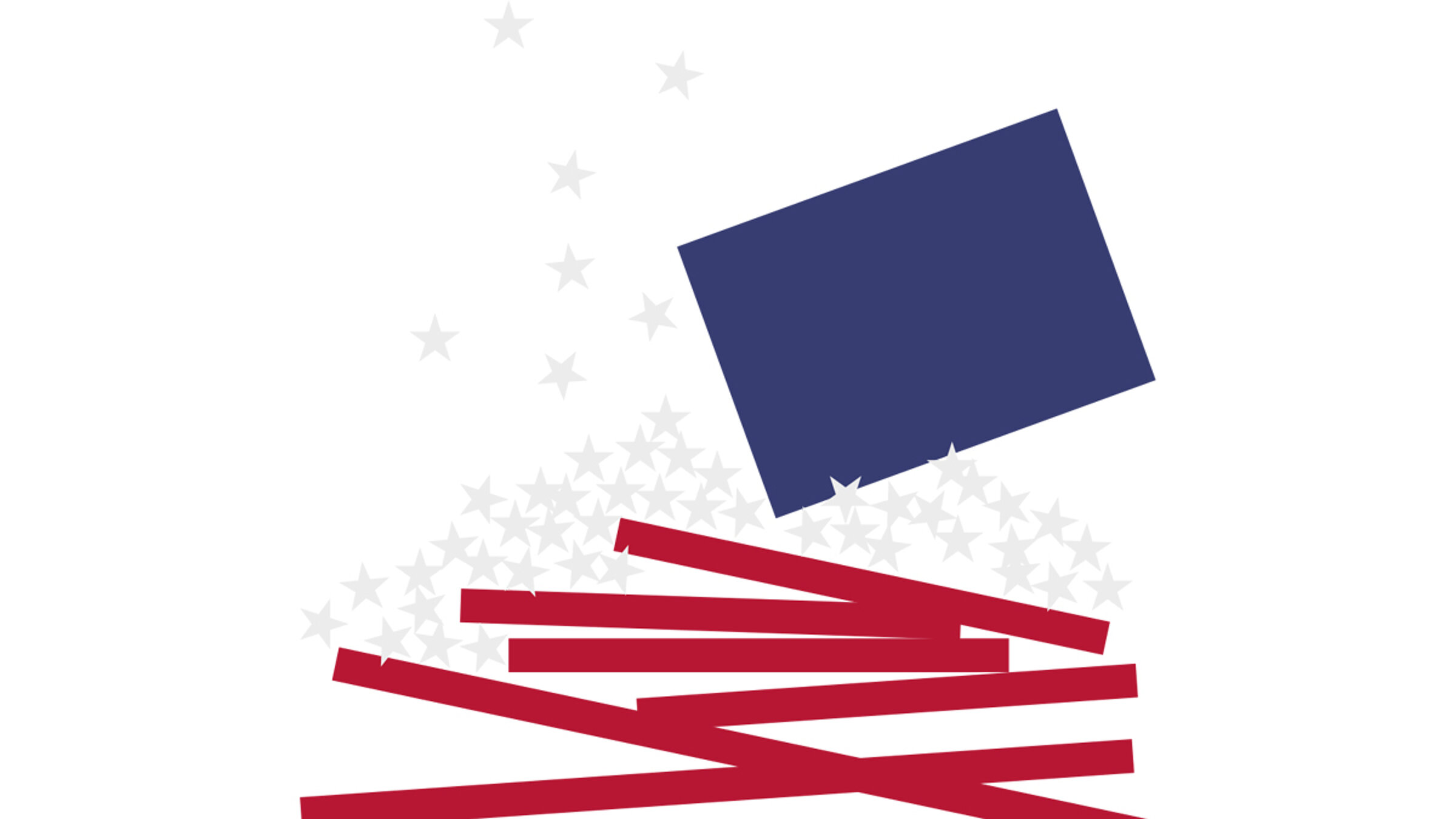
Herr Ziblatt, wie ist es anno 2021, im Anschluss an die Ära Trump, um die US-amerikanische Demokratie bestellt? Muss man sie heute als „defekt“ beschreiben?
Es ist viel schlimmer, als wir lange geglaubt haben. Das Problem reicht weit über Trump hinaus. Es ist strukturell bedingt und hat vor allem mit der Entwicklung der Republikanischen Partei in den letzten zwei Jahrzehnten zu tun. Neu und für die Demokratie gefährlich ist, dass sich Teile der Partei weigern, ein demokratisch verbürgtes Wahlergebnis anzuerkennen.
Ähnlich wie ihr Princetoner Kollege Jan-Werner Müller sind Sie der Auffassung, Trump sei kein historischer Betriebsunfall, sondern das personifizierte Ergebnis einer in den 1990er Jahren von den Republikanern initiierten Politikform, die ihre Gegner konsequent als Feinde behandelt. Welche Spuren hat diese Spaltungsrhetorik in der Gesellschaft hinterlassen?
Ja, diese spätestens mit Newt Gingrich einsetzende Diskursveränderung – seine Gegner konsequent als Feinde darzustellen – war ursprünglich strategisch intendiert. Gingrichs extreme Rhetorik zielte zunächst darauf ab, sich gegenüber innerparteilichen Konkurrent*innen zu profilieren. Die inzwischen weitverbreitete Gut-Böse-Erzählung gründet aber auch darin, dass sich große Teile der Republikaner und ihrer Wählerschaft als Hüter*innen eines weißen und christlichen Amerika begreifen. Die Folgen sind gravierend: Wenn Gegner zu Feinden werden, sind alle Mittel recht. Das hat auch der „Sturm aufs Kapitol“ gezeigt.
Weitaus gefährlicher als die vermeintliche Hypermoralisierung der Linken ist also die Entmoralisierung des Konservatismus. Auch weil informelle Regeln des Respekts erodieren.
Auf jeden Fall! Dafür sind die USA ein beredtes Beispiel. Als Politikwissenschaftler versuche ich einen objektiven Blick einzunehmen. Wenn ich die Parteienebene betrachte, muss ich nüchtern feststellen, dass sich die Demokraten weitgehend um die Einhaltung dieser informellen Normen bemühen. Die Republikaner tun das hingegen nicht.
Manche Beobachter*innen halten den Trumpismus in Anlehnung an Antonio Gramsci für ein krisenbedingtes Übergangsphänomen. Das neoliberale System sei am Ende – ein neues Paradigma aber zeichne sich nicht ab. Der Populismus versuche, diese Lücke zu schließen. Was halten Sie von dieser Diagnose?
Ich stimme zu, dass wir in einer Art Übergangsphase leben. Aus meiner Sicht geht es aber weniger um das Ende des Neoliberalismus als um die Transformation von monoethnischen zu multiethnischen Demokratien. Der Rechtspopulismus versucht krampfhaft etwas zu bewahren, das de facto nicht mehr existiert.
Wie hat sich die schleichende Verrottung der politischen Kultur in den USA auf das „liberale Skript“ im Allgemeinen ausgewirkt? Wurden Autokrat*innen von Brasília bis Budapest durch den Trumpismus gestärkt? Ist die liberale Ordnung gefährdeter denn je?
Im Vergleich zum Ende der 1990er Jahre auf jeden Fall. Wir leben heute in einer ganz anderen Weltordnung. Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs waren die USA und die EU die bestimmenden Großmächte, ausgestattet mit viel soft power – das liberale Modell war weltweit attraktiv. Heute wird es insbesondere durch den ökonomisch erfolgreichen chinesischen Autokratismus herausgefordert. Trump hat die demokratischen Systeme in ihrem Reputationskampf nicht bloß im Stich gelassen. Er hat selbst ein Vorbild für Populist*innen weltweit abgegeben. Und mit diesen gemeinsame Sache gemacht.
Sind Nationalist*innen heute transnational vernetzter als früher?
Ja, es gibt den Versuch, ein globales ideologisches Gegenprogramm zur liberalen Demokratie zu etablieren. Die Vernetzung von Rechtsextremen gab es aber schon früher. Ein Blick in die 1920er Jahre zeigt, dass der internationale Nationalismus eine große Gefahr darstellt. Aber natürlich impliziert diese Konzeption einen eklatanten Widerspruch – dieser ist die strukturelle Schwäche des Projekts.
In „Wie Demokratien sterben“ erklären Sie, dass es ein globales nachwuchsautokratisches Programm gibt, mit dem sich demokratische Institutionen entkernen lassen. Was sind die Merkmale dieser Strategie?
Da ist zum einen die erwähnte Freund-Feind-Rhetorik und die Behauptung der Verkörperung des einzig wahren Volkswillens. Zum anderen eine auf Institutionen gerichtete Strategie, die sich in drei Schritte untergliedert. Erstens nimmt man die „Schiedsrichter“ ins Visier – Polizei, Gerichte, Nachrichtendienste. Zweitens werden „Schlüsselspieler“ – Medien, politische Gegner und zivilgesellschaftliche Gruppen – neutralisiert. Drittens schreibt man die „Spielregeln“ neu und ändert zum Beispiel das Wahlsystem.
Sie sagen, Demokratien würden schleichend vergehen, siechten allmählich vor sich hin. Systeme würden heute von innen attackiert, der Putsch als Mittel zum Regierungswechsel sei eine Methode des 20. Jahrhunderts. Sind Autokrat*innen heute klüger als früher?
Ja. Für diese Veränderung gibt es zwei Gründe. Erstens haben Autokrat*innen gelernt, dass ein weniger offensichtliches Vorgehen meist erfolgreicher ist. Zweitens liegt es daran, dass Wahlen zu einem internationalen kulturellen Gemeingut geworden sind. Dass sich Autokrat*innen ideologisch gegen die Demokratie positionieren, kommt kaum noch vor. Stattdessen tarnen sie sich, wie zum Beispiel Victor Orbán in Ungarn, als „illiberale Demokraten“.
Die Demokratie kann über Wahlen und andere demokratische Institutionen – also mit ihren ureigenen Mitteln – aus den Angeln gehoben werden. Wie lässt sich so etwas verhindern?
Zunächst muss man „autokratische Demokrat*innen“ erkennen. Hierfür eignet sich der Lackmustest des Politikwissenschaftlers Juan Linz. Wer seinen politischen Gegner delegitimiere, sich nicht von der Gewalt seiner Anhänger*innen distanziere, das demokratische Prozedere anzweifle und das Recht der Presse auf freie Berichterstattung attackiere, sei potenziell gefährlich. Schwierig wird es mit jenen, die Linz mit Blick auf die Demokratie als „semiloyal“ beschreibt. Der Test muss insofern erweitert werden, um die subtileren Akteur*innen und ihre oft zweideutige Rhetorik in den Blick zu kriegen.
Wie kann man Autokrat*innen demokratisch bekämpfen, wenn sie sich erstmal etabliert haben? Was tun, wenn das normative Gerüst bereits morsch geworden ist? Zeigt nicht das Beispiel USA, dass die besten Institutionen wenig helfen, wenn weite Teile der Zivilgesellschaft die demokratische Erosion entweder nicht bemerken, ihr teilnahmslos begegnen oder sie sogar aktiv befördern?
Das ist ein großes Problem. Allerdings haben gerade die USA im November 2020 gezeigt, wie man Autokrat*innen wieder loswird. Zum Beispiel mit einer geschlossenen und gut finanzierten Opposition. Das Wahlsystem hat trotz aller Fehler funktioniert, die Demokraten waren gut organisiert. Aber auch die etwa durch die Bürgerrechtsbewegung gewonnenen kulturellen Errungenschaften haben eine Rolle gespielt. In der Türkei oder Ungarn etwa ist die Opposition zerklüftet, das ist ein wesentlicher Unterschied. Es braucht sowohl eine gut organisierte Opposition als auch eine wache Zivilgesellschaft, um Autokrat*innen bekämpfen zu können ...
... ein Zusammenspiel aus Werten und Institutionen.
Ja, wobei ich glaube, dass die normative Frage zuweilen überschätzt wird. Es gibt in den meisten Gesellschaften etwa 30 Prozent antidemokratische Einstellungen. Die Frage ist, ob diese Minderheit die Macht erringt. Die Geschichte zeigt, dass die semiloyalen Systemparteien hier genauso gefährlich sind wie die antisystemischen Parteien, weil sie eine Scharnierfunktion innehaben und in der Vergangenheit oft als Steigbügelhalter fungiert haben. Etwa die DNVP in der Weimarer Republik oder die konservative Partei in Spanien in den 1930er Jahren.
Solange sich der Konservatismus an moralische Standards hält, hat der Faschismus es schwer?
Ganz genau.
Trotz oder gerade wegen der durch ihn angerichteten Verheerungen hat der Trumpismus viele Demokrat*innen weltweit aus ihrer Lethargie gerissen. Sind demokratische Gesellschaften jetzt wachsamer, da die größte von ihnen unter Druck geraten ist? Erlebt die Demokratie im Augenblick größter Gefahr ein Comeback?
Dem würde ich zustimmen. Die Krise hat eine große Gegenmobilisierung bewirkt. Man sieht das in den USA. Die Bürgerrechtsbewegung ist dort viel robuster geworden. In Buchclubs und Bibliotheken wird über Demokratie diskutiert. Sie wird nicht mehr als selbstverständlich angesehen. Das ist eine gute Entwicklung.
Vor welchen Herausforderungen stehen die liberal-demokratischen Systeme der Gegenwart? Und welche Lehren lassen sich aus den letzten Jahren für ihre Verteidigung ziehen?
Was wir sehen, ist, dass die starke Polarisierung eine institutionelle Dysfunktionalität bewirkt. Es wird immer schwieriger, die großen Herausforderungen der Zeit – Klima, Ungleichheit, Pandemie – zu lösen, weil diese dysfunktionale Tendenz in vielen Ländern vorherrschend ist. Zentral für die Verteidigung der Demokratie ist außerdem, dass verschiedene Schlüsselbereiche – die Presse, die Rechtsprechung, die Bürokratie, das Militär – ihre normativen Maßstäbe und professionellen Ethiken bewahren. Dann haben Autokrat*innen es schwer.
Daniel Ziblatt ist Eaton-Professor für Regierungswissenschaften an der Harvard Universität und seit Oktober 2020 Direktor der Abteilung „Transformationen der Demokratie“ am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB). Sein mit Steven Levitsky verfasstes Buch „Wie Demokratien sterben“ erschien 2018 bei DVA.
Stand: Dezember 2021

