In Zeiten von Populismus und Demokratiemüdigkeit gelten Bürger*innenräte als probates Gegenmittel, weil sie konkrete Lösungen an der Basis erarbeiten – und den mühsamen Weg zum politischen Kompromiss erlebbar machen
Text: Daniel Erk
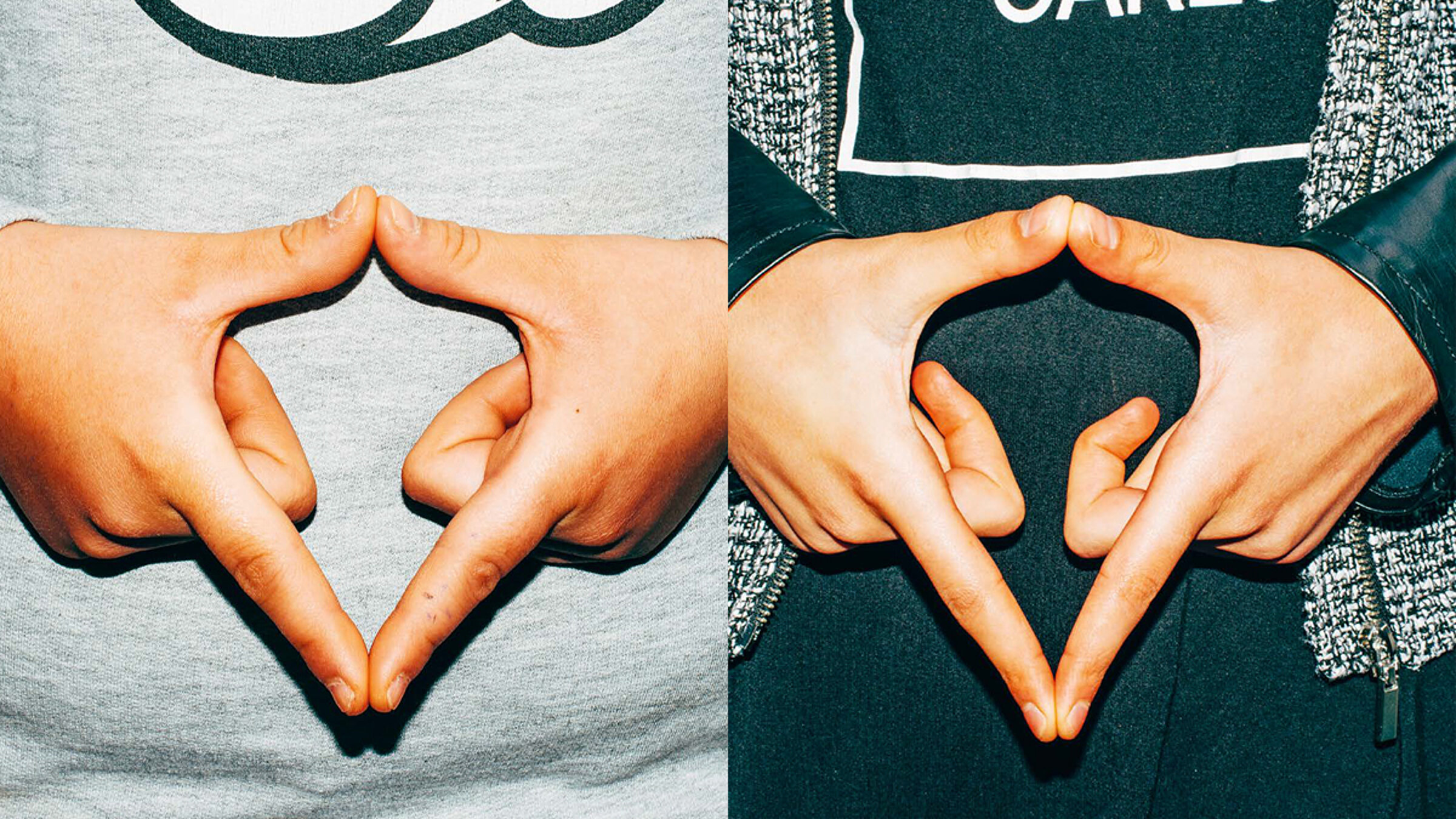
Was braucht es für eine kleine demokratische Revolution? Eine Gruppe von Entschlossenen. Zeit. Die Unterstützung wichtiger Stellen. Momentum. Wissen. Und, wie oft im Leben: Ein bisschen Glück. Katharina Hübl hatte alles.
Als sich Hübl 2017 aufmachte, in Berlin-Friedenau den ersten Bürger*innenrat zu etablieren, hatte sie eben ihren Beruf als Psychologin aufgegeben und war in Rente gegangen. Sie war gut vernetzt und hatte einen politisch interessierten Freundeskreis, der sich um den Zustand der Demokratie und den gesellschaftlichen Zusammenhalt sorgte – und den Drang verspürte, Politik selbst in die Hand zu nehmen. „Wir wollten Pegida, den aufkommenden Populismus und Rassismus nicht einfach hinnehmen, sondern einen Akzent dagegensetzen, und zwar am liebsten ganz konkret – nämlich in der Kommunalpolitik“, sagt Hübl.
Vor allem aber hatte Hübl einen entscheidenden Vorteil: Sie war in Vorarlberg aufgewachsen. Seit in dem kleinen österreichischen Bundesland 2006 die ersten modernen Bürger*innenräte in Europa durchgeführt wurden und seit 2011 halbjährlich stattfinden, gilt das westlichste Bundesland Österreichs als Inspiration und Referenz in Sachen Bürgerbeteiligung. Und dann hatte Hübl auch noch Glück. Mit dem Potsdamer Politikwissenschaftler Daniel Oppold fand sie einen Unterstützer, der 2012 selbst bei einem Vorarlberger Bürger*innenrat mitgewirkt hatte und am Potsdamer Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung (IASS) zu Formen bürgerschaftlicher Partizipation forscht. Hübl wusste, dass es gehen würde; Oppold wusste, wie. Damit kam zusammen, was es für die kleine demokratische Revolution in Friedenau brauchte.
Radwege, Grünflächen und bezahlbare Mieten
Mit ihren Friedenauer Freund*innen, mit denen sie zuvor die Initiative „Nur Mut!“ gegründet hatte, setzte Hübl viele Hebel in Bewegung: Sie warben im Privaten und auf Friedenauer Märkten um Aufmerksamkeit. Mit der Fachkompetenz von Daniel Oppold konnten sie innerhalb von nur sechs Monaten die Bezirksbürgermeisterin von Tempelhof-Schöneberg davon überzeugen, ihre Idee zu unterstützen und tatsächlich einen Bürger*innenrat in Friedenau einzuführen. Sie warben sogar Demokratiefördermittel des Berliner Senats ein. Das Projekt wuchs so schnell, wie es entstanden war: Am Ende fanden sieben Räte statt – in jedem Ortsteil des Bezirks einer.
Das Ziel von Hübl und Oppold war es, für das Forum auch Menschen zu gewinnen, die sonst weniger an demokratischen und gemeinschaftlichen Entscheidungen teilnehmen. Die Friedenauer Bürger*innenräte sollten zwölf bis 15 zufällig ausgewählte Bürger*innen versammeln, die die Gesellschaft nach Alter, Geschlecht und Bildungsgrad repräsentativ abbilden. Die Daten dafür bekamen Hübl und Oppold aus dem Melderegister. Die Bürgermeisterin von Tempelhof-Schöneberg lud persönlich ein.
Die auf diese Weise zufällig zusammengesetzten Bürger*innenräte trafen sich jeweils zu einem zweitägigen Workshop, der von Oppold und seinem Team moderiert wurde. Die Ergebnisse der Beratungen wurden der Bezirksbürgermeisterin, der Bezirksverordnetenversammlung sowie der Öffentlichkeit der jeweiligen Kieze anschließend in sogenannten Bürgercafés vorgestellt. Im Idealfall, so die Idee, sollten die Vorschläge so bestechend sein, dass die Abgeordneten der Bezirksverordnetenversammlung sie demokratisch legitimieren.
Am Ende waren die Forderungen sehr konkret: Mehr Platz, um Wege mit dem Rad zurückzulegen, mehr öffentliche Toiletten und weniger Wettbüros wünschten sich die Teilnehmenden aus Friedenau, außerdem die Pflege von Grünflächen und bezahlbare Mieten für einen Kiez, der nicht nur für Reiche erschwinglich bleiben sollte. Auch wenn die Ergebnisse nicht überraschend waren: Für Berlin waren die Friedenauer Räte eine demokratische Innovation. Und sie haben aufs Neue bewiesen, dass das Format gut geeignet ist, um bürgernahe Themen zu identifizieren, Konsens herzustellen und greifbare Forderungen aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger zu formulieren.
Ein Erfolgsmodell auf vielen Ebenen
Seit der erste Rat 2003 im vorarlbergischen Wolfurt stattfand, haben Bürger*innenräte viel Begeisterung hervorgerufen: In Österreich hat neben Vorarlberg eine ganze Reihe weiterer Bundesländer auf Kommunal- und Landesebene Bürgerversammlungen durchgeführt, teils mit thematischen Schwerpunkten, die vom „Frausein in Wien“ bis zur „wirtschaftlichen Zukunft Kärntens“ reichten. In Ostbelgien hat die Selbstverwaltung der deutschsprachigen Minderheit bereits zwei Bürger*innenräte eingesetzt, die sich mit der Lage der Pflege und inklusiver Bildung in ihrer Region befassten.
In Deutschland fanden neben den Friedenauer Räten knapp 20 Bürger*innenräte auf lokaler Ebene statt, vom „Bürgerforum Corona“ in Baden-Württemberg bis zum Bürger*innenrat „Leitbild Schwerin 2020“, weitere zwölf sind angekündigt. Was auch daran liegt, dass die Rahmenbedingungen immer besser werden: In Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Thüringen haben die Regierungen 2020 beschlossen, das Format auf Landes- und Kommunalebene zu etablieren. Und auf Bundesebene fanden bisher vier Foren statt. Zwei wurden von Stiftungen organisiert, zur Klimakrise und zur Zukunft der Bildung, zwei weitere kamen auf Initiative des Bundestages zusammen – der eine zur Demokratie allgemein, der andere zu „Deutschlands Rolle in der Welt“. Im daraus entwickelten Bürgergutachten heißt es, Deutschland solle „in der Rolle einer ‚Partnerin und Vermittlerin‘ mehr Verantwortung in der Welt übernehmen, solle für Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Wahrung der Menschenrechte sowie Frieden und Sicherheit stehen“. Bundestagspräsident und Schirmherr Wolfgang Schäuble hat die Ergebnisse persönlich in Empfang genommen und Vertreter*innen des Rates haben sie in verschiedenen Ausschüssen des Bundestages, bei Bundestagsfraktionen und Ministerien vorgestellt. Was sich konkret aus den Forderungen ergeben wird, bleibt jedoch abzuwarten.
Ort gelebter Auseinandersetzung
Ob ein Bürger*innenrat auf eigene Faust durchgeführt oder von einem Parlament explizit als Ergänzung angefragt wird und damit an gewählte Strukturen angebunden ist, sei im Kern der entscheidende Unterschied im weiten Feld der Bürger*innenräte, sagt der Politikwissenschaftler Andreas Schäfer. „Das sind ja Formate, die bisher so gut wie keine eigene Entscheidungsmacht haben.“ Schäfer analysiert am Lehrbereich Politische Soziologie und Sozialpolitik an der Humboldt-Universität zu Berlin (HU) den Zusammenhang zwischen politischen Kommunikations- und Entscheidungsprozessen aus demokratietheoretischer Perspektive. Dazu gehören auch sogenannte mini-publics, also „kleine Öffentlichkeiten“, zu denen wiederum Bürger*innenräte zählen, aber auch artverwandte Formate wie Bürger*innenforen oder Bürger*innenjurys.
Schäfer sieht in Bürger*innenräten auch einen Ausdruck dessen, was Habermas „deliberative Demokratie“ genannt hat – Orte gelebter, kommunikativer Auseinandersetzung, die im besten Falle zu einem Konsens führt. „Der große Vorteil von Bürger*innenräten und anderen mini-publics ist, dass sich durchschnittliche Bürger*innen intensiv und kollektiv mit einem politischen Problem auseinandersetzen und gemeinsam reflektierte Positionen entwickeln können“, sagt Schäfer. Bürger*innenräte sind damit auch ein Weg, um die Komplexität von Gesellschaft und Aushandlungsprozesse erlebbar zu machen.
Trotz ihrer strukturellen Machtlosigkeit und kniffeligen Legitimität, sagt Schäfer, seien gut gemachte Bürger*innenräte in der Lage, „die Politikferne der Bürger und die Bürgerferne der Politik“ zu überbrücken. Gerade das Beispiel des Bürger*innenrates im deutschsprachigen Ostbelgien habe gezeigt, dass „die Furcht vor dem Populismus ein Treiber war, sich mit demokratischen Innovationen zu beschäftigen.“ Ein Punkt, den auch Katharina Hübl in Friedenau beobachtet hat: „Natürlich zerbrechen sich die Politiker den Kopf, wenn ihnen die Leute weglaufen“, sagt sie. In der Konsequenz führt das laut Schäfer dazu, dass die Parlamente sich ihre Ergänzung in Form von Bürger*innenräten selbst beschaffen. Und das sei durchaus von Vorteil. Wenn nämlich die Initiative zu einem Bürger*innenrat vom Parlament komme und die Fraktionen des Bundestags eingebunden seien, Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble gar Schirmherr sei, dann seien die Aussichten auf Erfolg deutlich besser. Die institutionelle Anbindung helfe zudem, die Wirksamkeit von Bürger*innenräten zu erhöhen. Fehle sie, laufe die Unternehmung Gefahr, mit viel Aufwand und Pathos Ergebnisse ins Nichts hinein zu produzieren – und so den Frust über die Demokratie am Ende nur noch zu erhöhen.
Demokratieaufbau mit Mini-Publics
Thamy Pogrebinschi, die am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) zu demokratischen Innovationen in Lateinamerika forscht, hat 2009 ihren ersten Bürger*innenrat in Brasilien begleitet und eine Datenbank namens Latinno mit 3744 Bürger*innenräten und anderen mini-publics aus 18 Ländern von Argentinien bis Venezuela zusammengestellt. Sie zeigt eindrucksvoll die Vielfalt partizipativer Ideen und Anwendungen in Lateinamerika.
Für Pogrebinschi sind Bürger*innenräte keineswegs nur etwas für den „demokratiemüden“ Westen, sondern vor allem für Länder geeignet, in denen demokratische Teilhabe eben noch nicht konsolidiert ist. „In Lateinamerika gibt es Bürger*innenräte schon sehr lange, auch wenn sie oft institutionell anders organisiert sind. Räte, die die lokale und die nationale Ebene verbinden, sind in vielen Ländern sehr etabliert“, sagt die Wissenschaftlerin.
In Bogotá zum Beispiel sei mithilfe des Bürgermeisters ein Bürger*innenrat namens „Bogotá Citizen Assembly“ durchgeführt worden, bei dem einerseits 1000 Bürger*innen der Stadt repräsentativ als Diskutant*innen ausgewählt wurden, andererseits offene Foren ohne Zufallsauswahl organisiert wurden, an denen sich Vertreter*innen von NGOs sowie interessierte Bürger*innen beteiligen konnten. „In Lateinamerika mit seinen schwachen demokratischen Institutionen sind Bürgerr*innenräte auch ein Weg, die demokratische Kultur erst aufzubauen“, sagt Pogrebinschi. Die Frage aber, wie wirksam sie seien und ob sie von Regierungen und Parlamenten als legitim erachtet würden, hänge auch hier sehr stark vom jeweiligen Thema und dessen politischer und gesellschaftlicher Akzeptanz ab. Mithilfe ihrer Datenbank ließe sich aber erkennen: Sowohl bei den Anwendungsfällen als auch bei den Themen und Zielen seien den Bürger*innenräten kaum Grenzen gesetzt.
Gelebte Demokratie im Trippelschritt
Wie wirksam ein Bürger*innenrat tatsächlich ist, ist aber auch eine Frage der Kommunikation. Als es in Friedenau schließlich zum Austausch zwischen Bürger*innenrat, Parlament und Verwaltung kam, stellte sich heraus, dass manches von dem, was die Bürger*innen wünschten, entweder längst angedacht, bereits wieder verworfen, in der Umsetzung oder längst umgesetzt war. Es wusste bloß niemand davon.
Weshalb der Bezirk Tempelhof-Schöneberg eine Stabsstelle für Dialog und Beteiligung im Bürgeramt und einen Newsletter einführte, um die Kommunikation zwischen Parlament, Verwaltung und Bürgerschaft zu verbessern. Für manche der Teilnehmer*innen sei das ernüchternd gewesen, räumt Katharina Hübl ein. Dass nach all den Mühen und Diskussionen nicht mehr herausgekommen sei. Aber Kommunikation sei eben immens wichtig.
Andererseits, erzählt Hübl, sei sie auch bei Familienbesuchen in Vorarlberg immer wieder verblüfft, wie wenig die Leute dort von ihren Bürger*innenräten wüssten. Von deren Einfluss, Möglichkeiten und Potenzial. Und vielleicht ist genau das eine der zentralen Lektionen: Dass Demokratie und eine inklusive Gesellschaft nicht nur an den großen Problemen scheitern können. Sondern auch an den kleinen, banalen Kommunikationsdefiziten.
Wenn Fortschritte durch Bürger*innenräte nur in Trippelschritten vorankommen, ist das laut Andreas Schäfer von der HU kein Nachteil, vielmehr eine Übung in gelebter Demokratie, Kompromissfindung und verwaltungsrechtlicher Umsetzung von Politik. „Eine Hoffnung der politischen Institutionen und Akteure, die solche Bürger*innenräte abhalten, ist ja auch, dass die Bevölkerung ein realistischeres Bild von demokratischen Entscheidungsprozessen bekommt“, sagt Schäfer. „Dass die Leute verstehen, vor welchen Herausforderungen die Parlamentarierinnen und Parlamentarier stehen.“
Stand: Dezember 2021

