Immuntherapien sind zur vierten Säule der Krebsmedizin gereift. Sie programmieren körpereigene Immunzellen um, damit diese lernen, entartete Zellen vehement zu bekämpfen. Manch Todgeweihtem hat das bereits das Leben gerettet
Text: Susanne Donner

Eine Prise Selbstironie ist immer dabei, wenn Ernst Agneter von seiner Krebserkrankung erzählt, die ihn eigentlich unter die Erde hätte befördern müssen. Zwölf Jahre liegt es zurück, dass er von einem Tauchurlaub auf den Malediven heimkehrte und prompt eine Lungenentzündung bekam. Er schob es auf verkeimte Schläuche an der Sauerstoffflasche. Doch trotz Antibiotika besserte sich seine Infektion nicht und „fürchterliche Schweißausbrüche“ kamen hinzu. „Ein Jahr später war ich am Ende meiner pharmakologischen Weisheit“, sagt Agneter, seines Zeichens Pharmakologieprofessor an der Universität Wien. Eine Kollegin überredete ihn, die Lunge röntgen zu lassen, und entdeckte eine Metastase, die den rechten Lungenflügel abdrückte. Die Tochtergeschwulst stammte von einem Nierenzellkarzinom.
Patient*innen mit diesem Tumor im fortgeschrittenen Stadium leben in aller Regel nurmehr einige Monate. Agneter weiß das: „Ich dachte damals: Brauche ich noch einen Rasierschaum oder geht sich das eh aus?“ Er lacht leise.
Chirurgen entfernen Agneters rechten Lungenflügel. Ein Spezialist verglüht die Metastasen eine nach der anderen in mehr als einer Handvoll Operationen. Und Agneter bekommt als einzige Arznei das Krebsmedikament Nivolumab. Dieser Antikörper aktiviert sein Immunsystem, um die Krebszellen zu beseitigen. Der Wiener Professor ist fest entschlossen zu kämpfen: „Mein Ziel war zu leben.“
Agneter bekommt keine Chemotherapie und keine Bestrahlung, sondern neben den OPs das Modernste, was die Krebsmedizin zu bieten hat: eine Immuntherapie. Diese ist zur wichtigen neuen Stütze der Krebsmedizin geworden. Für einige Betroffene erweist sie sich als letzte Rettung.
Die Immuntherapie entstand aus Beobachtungen, die Forschende schon in den 50er Jahren machten: Überträgt man beispielsweise von einer Maus ein kleines Stück eines künstlich hervorgerufenen Tumors auf eine genetisch identische Zwillingsmaus, kann deren Immunsystem die transplantierte Geschwulst bemerken und beseitigen. Später deckte der in den USA forschende Krebsimmunologe und ehemalige Einstein Visiting Fellow Hans Schreiber auf, dass es die T-Zellen des Immunsystems sind, die den Krebs bekämpfen. Sie erkennen bestimmte Proteine auf der Oberfläche der Krebszellen.
Nach und nach wurde klar: Die menschliche Körperabwehr ist imstande, sämtliche Gewebe auf mutierte Zellen – die Anfänge eines jeden Tumors – zu scannen und diese abzuräumen, noch ehe sie sich nennenswert vermehren können. Das Immunsystem und besonders die T-Zellen entscheiden über gesund oder krebskrank. „Als dieser Beweis erbracht war, keimte die Hoffnung auf, dass man das Immunsystem zur Behandlung von Krebs einspannen könnte“, sagt Thomas Kammertöns, Immunologe am Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin (MDC) und der Berliner Charité.
Ende der 90er Jahre kamen die ersten immuntherapeutischen Medikamente auf der Basis von Antikörpern gegen Krebs in die Apotheken. Sie rütteln die Körperpolizei gewissermaßen wach, indem sie sich an bestimmte Strukturen auf der Oberfläche spezifischer Krebszellen heften und diese dem Immunsystem präsentieren, damit es gegen die Tumorzellen vorgehen kann. Der erste zugelassene Antikörper, Rituximab, wird bis heute zur Behandlung von Lymphdrüsenkrebs eingesetzt.
Einen besonderen Schub erfuhr das Forschungsfeld, als James Allison aus den USA und Tasuku Honjo aus Japan auffiel, dass auf den T-Zellen zwei „Kontrollpunkte“ für das Immunsystem sitzen. Die Krebszellen können Stoffe absondern, die an diese Kontrollpunkte binden. In der Folge wird das Immunsystem träge und lässt den Tumor sprießen. Für diese Entdeckung bekamen Honjo und Allison später den Nobelpreis. Und darauf aufbauend entwickelten Forschende den Antikörper Ipilimumab gegen fortgeschrittenen Hautkrebs, der 2011 zugelassen wurde. Ipilimumab verhindert, dass Krebszellen den Kontrollpunkt der T-Zellen lahmlegen. „Immuncheckpointinhibitoren“ heißen Antikörper, die so wirken. Sie lösen quasi die Bremsen des Immunsystems. Die körpereigenen T-Zellen gehen sodann auf die Krebszellen los. „Was uns alle fasziniert, ist, dass man damit austherapierte Tumore, bei denen die Chemotherapie und die Bestrahlung nichts mehr hilft, bezwingen kann“, sagt Kammertöns.
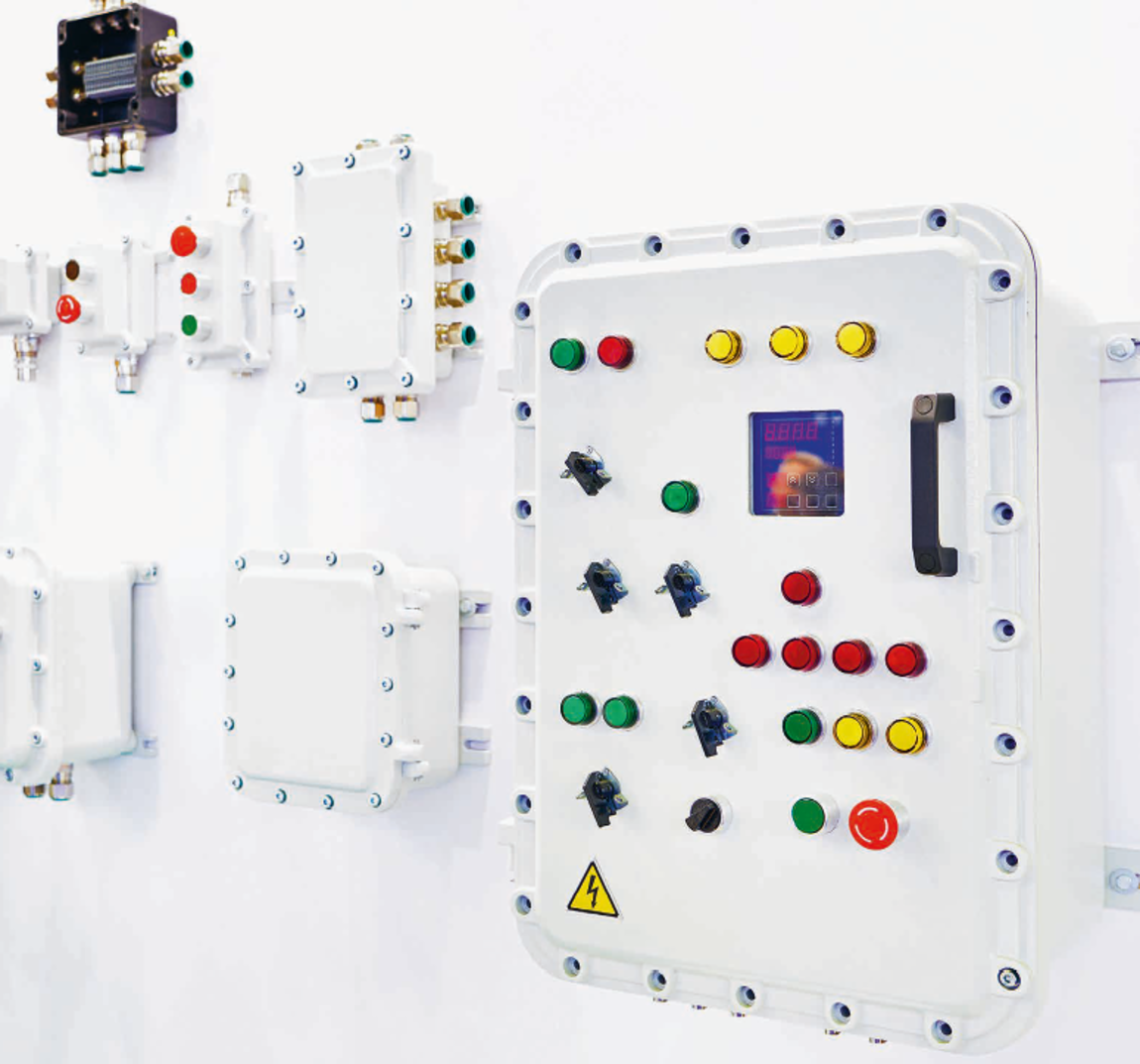
Mittlerweile haben Pharmahersteller gut ein Dutzend Immuncheckpointinhibitoren auf den Markt gebracht. Auch die Arznei Nivolumab, die Ernst Agneter bekommt, gehört in diese Klasse neuer Medikamente. Sie sorgen dafür, dass Lungenkrebserkrankte länger leben können. Das gilt sogar, wenn der Tumor bereits Tochtergeschwulste gebildet hat – einst ein Todesurteil. Auch gegen den gefährlichen schwarzen Hautkrebs sind zu Ipilimumab noch zwei weitere immuntherapeutische Arzneien hinzugekommen. „Damit kann man die Krankheit auch im fortgeschrittenen Stadium noch gut behandeln“, erklärt der Onkologe Georg Hilfenhaus von der Berliner Charité. Mitunter verschwinden sogar große Tumore gänzlich aus den Röntgenaufnahmen. Unter jenen Patient*innen, denen Ärzt*innen einst nur noch ein Jahr gaben, lebt nun etwa jeder Fünfte bereits länger als zehn Jahre.
Langfristig schätzen Georg Hilfenhaus und Thomas Kammertöns allerdings eine andere Form der Immuntherapie als noch potenter ein: die T-Zell-Therapie. Dabei dienen nicht etwa Antikörper, sondern im Reinraum veränderte T-Zellen als Therapeutikum. Sie lassen sich außerhalb des Körpers gentechnisch so umrüsten, dass sie gezielt Krebszellen erkennen.
„Der Durchbruch für die T-Zell-Therapien ging interessanterweise von der Kindermedizin aus. Es ist sehr selten, dass Neuentwicklungen bei den Kleinen beginnen“, berichtet Kinderonkologin Angelika Eggert von der Berliner Charité. Die Not war jedoch entsprechend groß. Immer wieder lagen auf den Intensivstationen unheilbar kranke Kinder mit B-Zell-Lymphomen, bei denen sich eine bestimmte Art der weißen Blutkörperchen, die B-Lymphozyten, unkontrolliert vermehren, sowie mit bestimmten Leukämien, gegen die weder Chemotherapien noch Stammzelltransplantationen halfen. Die Mediziner*innen hatten für sie nichts mehr in der Hand.
Wie ein Lauffeuer verbreitete sich daher die Nachricht, dass einige dieser Kinder auf einmal keine Krebszellen mehr in ihrem Blutkreislauf oder in den Lymphen aufwiesen, nachdem sie eine T-Zell-Therapie erhalten hatten. Das Fachjournal Science feierte dies als Durchbruch des Jahres 2013. Und 2018 ließ die Europäische Arzneimittelbehörde T-Zell-Therapeutika gegen bestimmte B-Zell-Lymphome und Leukämien im fortgeschrittenen Stadium zu.

Der Ansatz ist ein pharmakologisches Novum: Den Patient*innen werden ausschließlich die weißen Blutplättchen aus dem Blut entnommen und die T-Zellen daraus isoliert. Ein darauf spezialisiertes Pharmaunternehmen verändert die T-Zellen in seinen Reinräumen so, dass sie sich an ein Protein auf der Oberfläche von Krebszellen heften. Sie tragen quasi einen gegen den Krebs gerichteten Angelhaken. Dieser heißt „chimärer Antigenrezeptor“, kurz „CAR“. Diese CAR-T-Zellen vermehrt der Pharmahersteller. Im Krankenhaus werden sie den Krebserkrankten dann in großer Zahl – mehr als 100 Millionen – mit einer Infusion verabreicht. In der Folge zerfällt der Tumor bei knapp zwei Drittel der Betroffenen nach einigen Wochen, berichtet Eggert. Bei rund der Hälfte der Leukämiepatient*innen und einem Drittel der Lymphompatient*innen zirkulieren schließlich keine nachweisbaren Krebszellen mehr im Körper, wie die Daten aus den 18 deutschen Zentren belegen, die die CAR-T-Zell-Therapie anwenden. Diese sind bis dato die einzig zugelassenen T-Zell-Therapien. Sie werden nur gegen bestimmte Leukämien und B-Zelllymphome eingesetzt. Es gibt bei Kindern allerdings rund ein Drittel, die nicht auf die Therapie ansprechen, bedauert Eggert. „Wir wissen noch nicht, warum.“ Auch kann es zu einer Überreaktion des Immunsystems kommen, einem Zytokinsturm. Die Betroffenen plagt dann Atemnot, Herzrasen und hohes Fieber. Kinder müssen sich deshalb unbedingt im Krankenhaus befinden, wenn die Therapie angewendet wird.
Damit haben CAR-T-Zell-Therapien bis dato noch nicht den fulminanten Stellenwert, den die Immuncheckpointinhibitoren von Lungenkrebs bis zu Hautkrebs haben. Noch mehr betrübt die Krebsmedizinforschenden, dass Tumore, die sich nicht im Blut oder den Lymphen befinden, sondern in festen Gewebeverbänden wachsen und deshalb „solide Tumore“ heißen, mehr schlecht als recht auf Immuntherapien ansprechen. Dazu zählen Hirntumore, Brust- und Darmkrebs, schlechthin die meisten Krebserkrankungen. Sie umgeben sich mit einer Schutzhülle aus verschiedenen Zellen, darunter Fibroblasten und Fresszellen, die den Krebs für das Immunsystem unsichtbar machen und es „milde stimmen“. „Beim besonders bedrohlichen Pankreaskarzinom besteht die Krebsgeschwulst zu 80 Prozent aus diesem Schutzwall“, schildert Georg Hilfenhaus, der täglich betroffene Patient*innen sieht.
Er und Thomas Kammertöns hoffen, mit andersartigen T-Zellen – also nicht solche mit einem chimären Antigenrezeptor – gegen solide Tumore anzukommen. „In Krebszellen gibt es immer verschiedene Mutationen und es ist die Frage, gegen welche sich die T-Zellen richten müssen, um maximale Heilungserfolge zu erzielen“, erläutert Kammertöns. „Wir denken, es müssten solche Mutationen sein, die das Wachstum des gesamten Tumors treiben und schon am Anfang der Erkrankung da waren.“ „Wurzelmutationen“ nennt er sie. Gentechnisch veränderte T-Zellen, die sich gegen diese Wurzel des Bösen richten, sollten besonders wirksam sein, hoffen er und Thomas Blankenstein, Tumorimmunologe am MDC. Letzterer verfolgt bereits seit 2006 mit seiner Arbeitsgruppe diese Idee. Bis zum möglichen Beweis ihrer Tragfähigkeit werden allerdings noch einige klinische Studien nötig sein.
Auch zahlreiche andere Forschungsgruppen experimentieren mit T-Zell-Therapien. Beispielsweise hat die Tumorbiologin Uta Höpken vom MDC modifizierte CAR-T-Zell-Therapeutika entwickelt, die sie an Patient*innen mit chronisch-lymphatischen Leukämien und follikulären Lymphomen einsetzen möchte. An weiteren Kandidaten gegen Hirntumoren und Knochenmarkkrebs arbeitet ihr Team im Labor.
Unterdessen versteht man eine tückische Eigenart vieler Krebserkrankungen immer besser, die sie oft schwer besiegbar macht. „Wenn man Gewebe aus verschiedenen Arealen desselben Tumors entnimmt, unterscheiden sich die Krebszellen auf genetischer Ebene. Der Krebs ist ein erstaunlich heterogenes Gebilde. Und dann verändert er sich auch noch im Laufe der Therapie, sodass wir einen sich ständig verändernden Widersacher vor uns haben“, erklärt Eggert. Richtig sei es deshalb, das Erbgut des Tumors in jedem Erkrankten bis auf die Ebene einzelner Zellen zu dechiffrieren. Denn jeder Kranke hat seine ganz eigene Krebserkrankung.
BioNTech, berühmt für seinen Covid-Impfstoff, denkt diesen Ansatz weiter und arbeitet an einer vollkommen individuellen Therapie gegen Krebs. Dafür braucht das Mainzer Unternehmen zunächst etwas Gewebe aus dem Tumor. Das Erbgut der Krebszellen wie auch die Proteine in und auf den Krebszellen werden vollautomatisch ausgelesen. Ein Computerprogramm fischt daraus jene 20 Veränderungen, gegen die das körpereigene Immunsystem am ehesten vorgehen könnte. Gegen diese 20 Kandidaten erzeugt das Mainzer Unternehmen einen individuellen Medikamentencocktail, eine mRNA-Therapie, die vollautomatisiert und ohne direkten menschlichen Eingriff in einer Fabrik erzeugt wird.
Wie die Arznei wirkt, lässt sich an der im Oktober 2021 angelaufenen klinischen Studie an 200 Patient*innen mit fortgeschrittenem und unbehandelbarem Darmkrebs erklären. Für die 20 potentesten Veränderungen auf den Krebszellen einer einzelnen Patientin erzeugt BioNTech die passende Boten-RNA. Das ist eine Minibauanleitung für die veränderten Proteine. Die Boten-RNA wird anschließend gespritzt. Sie sorgt dafür, dass bestimmte Körperzellen jene 20 Krebseiweiße produzieren und auf ihrer Oberfläche präsentieren. Die T-Zellen des Immunsystems lernen diese als fremd zu erkennen und ziehen in der Folge auch gegen die identisch ausgestatteten Krebszellen ins Feld. Der mRNA-Cocktail gegen Darmkrebs soll den Tumor ausradieren. Nach dem gleichen Prinzip funktioniert die mRNA-Impfung gegen Covid. Die Ergebnisse der Studie stehen noch aus.
Ob diese individuelle Medizin den Durchbruch bringt, ist ebenfalls offen. Allemal hat die Krebsmedizin in den letzten Jahren so viel Neuland errungen wie kaum je zuvor. Für Ernst Agneter kam dieser Fortschritt gerade noch zur rechten Zeit.
Radiolog*innen finden schließlich keine Tumorreste mehr in seinem Körper. Oft sind sie in solchen Fällen nur so klein, dass sie mit bildgebenden Verfahren nicht mehr sichtbar sind. Aber Agneter ist siegesgewiss: „Ich betrachte mich als geheilt“, sagt er und gesteht, dass er sogar eigenmächtig das Medikament Nivolumab abgesetzt habe. Der Krebs ist seither tatsächlich nicht zurückgekehrt. „Ich tauche auch wieder“, erzählt er, „brauche halt ein bisschen mehr Sauerstoff mit nur einer halben Lunge.“
Stand: Dezember 2022

