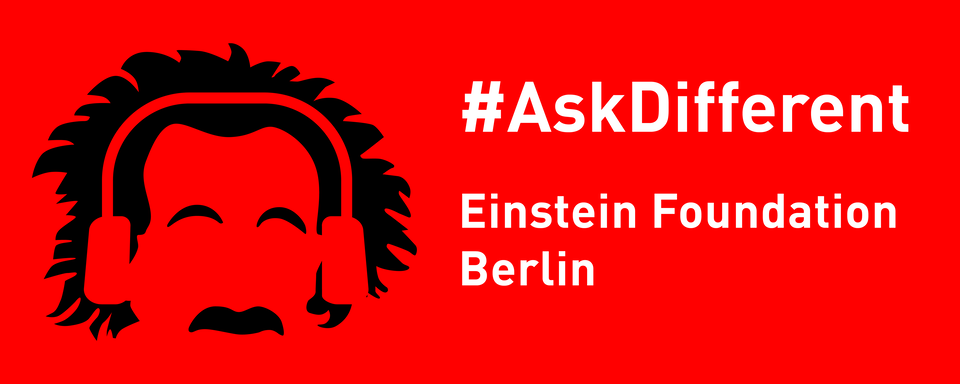
In der Podcast-Reihe #AskDifferent erzählen geförderte und mit der Stiftung verbundene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von den kleinen Schritten und großen Zufällen, die zu einer außergewöhnlichen Laufbahn geführt haben. Wir wollen wissen: Was treibt sie an, anders zu fragen, immer weiter zu fragen und unsere Welt bis ins kleinste Detail zu ergründen?