
E&B
Eric J. Johnson
Verborgene Partner:innen

E&B
Martin Skutella
Verknüpfte Probleme

E&B
Rudolf Zechner
Der Fettfresser
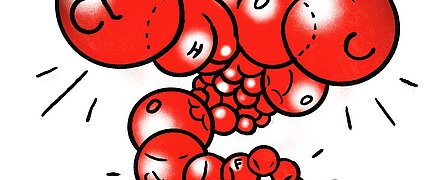
E&B
Sebastian Hasenstab-Riedel
Elemente der Extreme

E&B
Kathrin Zippel
Gläserne Zäune

E&B
Elke Weber
Am Siedepunkt
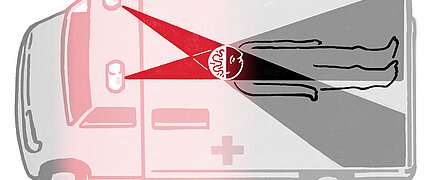
E&B
Alastair Buchan
Halbschatten des Lebens

E&B
Ludovic Vallier
Phönix der Zellen
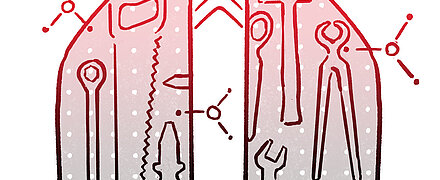
E&B
Marcus Mall
Molekulares Reparaturteam

E&B
Michael Goebel
Fließende Gewissheiten

E&B
Gwendolyn Sasse
Gesellschaft im Labor

E&B
Philipp Mergenthaler

